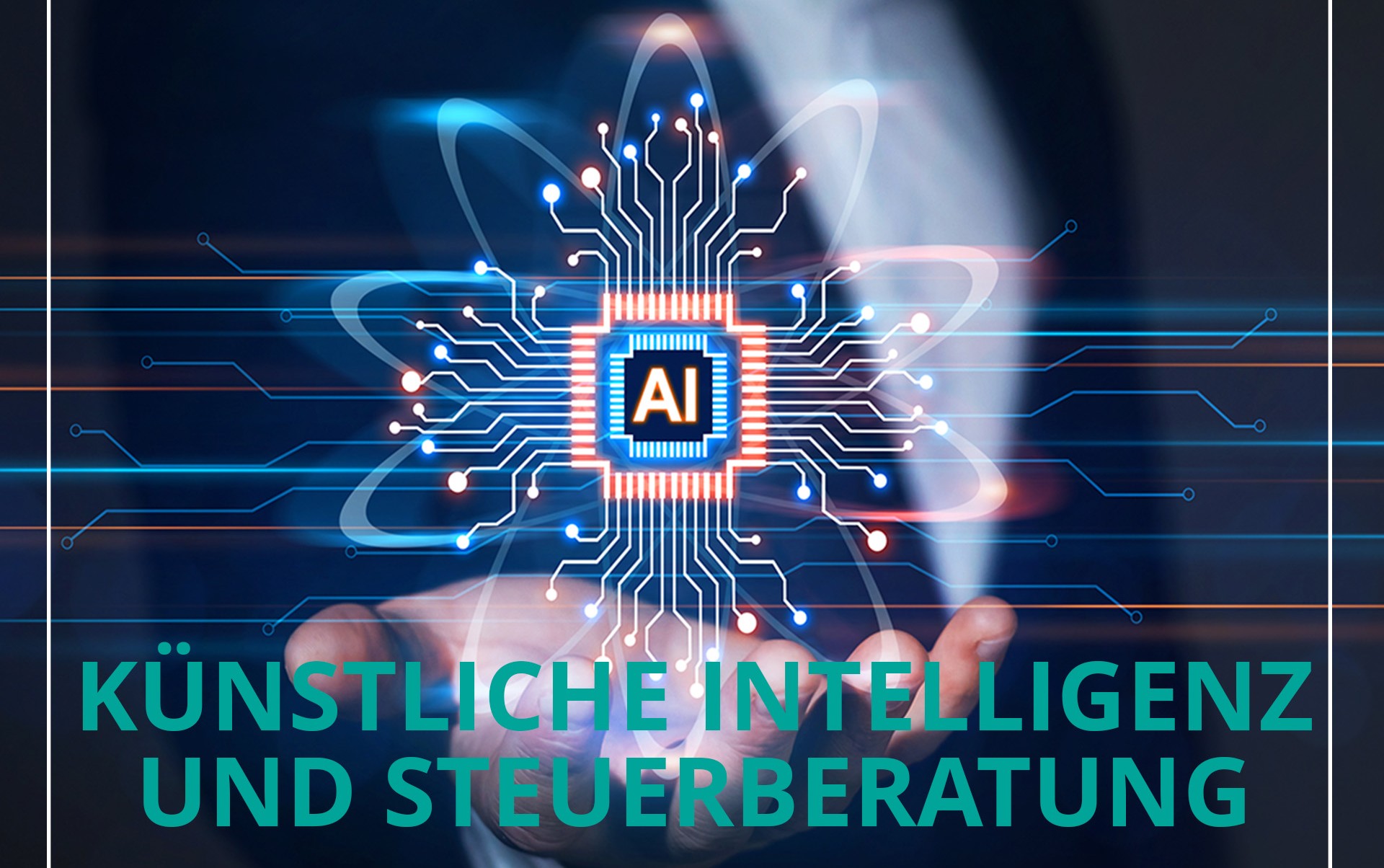Sonderausgabe zum Jahresende 2024
I. Unternehmer
1. Meldepflicht elektronischer Kassen
Ab dem 1.1.2025 gilt eine Meldepflicht für elektronische Kassensysteme. Danach müssen Unternehmer alle Registrierkassen und andere elektronische Aufzeichnungssysteme sowie die dazugehörigen zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtungen (TSE), die in ihrem Betrieb angeschafft wurden, melden. Die Meldung muss grundsätzlich innerhalb eines Monats erfolgen, falls die Kasse mit zertifizierter technischer Sicherheitseinrichtung ab dem 1.7.2025 angeschafft wird. Ist die Kasse vor dem 1.7.2025 angeschafft worden, genügt eine Mitteilung bis zum 31.7.2025. Die Mitteilungspflicht betrifft auch EU-Taxameter und Wegstreckenzähler bei Fahrzeugen (z. B. Mietwagen, Taxis) sowie sämtliche Software mit Kassenfunktion (z. B. Tablet-/App-Kassensysteme sowie Warenwirtschaftssysteme oder Hotelsoftware mit Kassenfunktion).
Hinweis: Die Meldepflicht betrifft ebenfalls gemietete oder geleaste Kassensysteme mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung. Ebenfalls innerhalb eines Monats gemeldet werden muss die Außerbetriebnahme einer solchen Kasse. Wird die Kasse vor dem 1.7.2025 außer Betrieb genommen, muss die Außerbetriebnahme nur gemeldet werden, wenn ihre Anschaffung zuvor gemeldet worden war. Die Meldungen können beispielsweise über das Programm „Mein ELSTER“ oder mittels Software mit sog. ERiC-Schnittstelle vorgenommen werden.
2. Pauschalsteuer auf Geschenke und Zuwendungen an Geschäftsfreunde
Neuigkeiten gibt es in Bezug auf die pauschale Besteuerung von Geschenken an Geschäftsfreunde oder Kunden: Für Geschenke oder freiwillige Zuwendungen an Geschäftsfreunde oder Kunden kann der Unternehmer die Versteuerung für den Beschenkten übernehmen und eine Pauschalsteuer in Höhe von 30 % des Wertes des Geschenkes zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer an das Finanzamt abführen.
Bei einer Einladung von Geschäftsfreunden oder Kunden in eine VIP-Loge, z. B in einer Sportarena, kann die Bemessungsgrundlage für die Pauschalsteuer nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) gemindert werden. So kann aus den Kosten für die Loge der Werbeanteil herausgerechnet werden. Denn die Werbung kommt den eingeladenen Geschäftsfreunden nicht zugute. Dies gilt auch dann, wenn im Logenpreis keine Bewirtung enthalten ist. Der Anteil für die Werbung ist in diesem Fall zu schätzen. Ist eine Bewirtung enthalten, erkennt die Finanzverwaltung einen Werbeanteil von 40 % an, um den die Bemessungsgrundlage zu mindern ist. Zudem bleiben die Kosten für die Logenplätze, die leer bleiben, außer Ansatz.
Hinweis: Der Unternehmer hat ein Wahlrecht, die Pauschalsteuer für den Kunden zu übernehmen. Stellt er keinen Antrag, obliegt die Versteuerung dem eingeladenen Kunden, sofern die Einladung bei ihm zu steuerpflichtigen Einnahmen führt.
Sofern sich der einladende Unternehmer für den Antrag auf Übernahme der Pauschalsteuer entscheidet, sollte er vorher prüfen, ob die Einladung für den Kunden überhaupt steuerpflichtig ist. Ist sie das nicht, weil der Kunde als Privatperson eingeladen wird, muss der einladende Unternehmer keine Pauschalsteuer entrichten. Lädt z. B. eine Bank ihre Privatkunden zu einer Schifffahrt mit Weinprobe oder zu einem Golfturnier ein, ist keine Pauschalsteuer abzuführen. Aus Sicht der Privatkunden ist die Einladung nämlich keine steuerpflichtige Einnahme.
Hinweis: Der einladende Unternehmer sollte daher sorgfältig dokumentieren, ob er Privatkunden einlädt, bei denen keine Pauschalsteuer anfällt, oder ob es sich bei den eingeladenen Kunden um Unternehmer handelt, die die Einladung im Rahmen ihrer geschäftlichen Beziehungen zum einladenden Unternehmer erhalten haben und deshalb die Einladung versteuern müssten.
3. Aufzeichnung von Bewirtungskosten
Aufmerksamkeit ist geboten, wenn ein Unternehmer Bewirtungsaufwendungen anlässlich einer Verkaufsveranstaltung tätigt, selbst wenn es sich nur um ein „normales“ Catering bzw. Buffet handelt. Denn dann muss er die Bewirtungsaufwendungen einzeln und getrennt von den sonstigen Betriebsausgaben aufzeichnen, da der Gesetzgeber bei bestimmten nur beschränkt abziehbaren Betriebsausgaben eine gesonderte Aufzeichnung der Aufwendungen verlangt, so z. B. bei Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass. Anderenfalls sind die Bewirtungsaufwendungen nach einem Urteil des FG Berlin-Brandenburg nicht absetzbar. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Bewirtung im Vordergrund der Veranstaltung gestanden hat.
Hinweise: Anders ist dies bei einer Veranstaltung, an der ausschließlich Arbeitnehmer teilnehmen, da es sich hierbei nicht um eine Bewirtung aus geschäftlichem Anlass handelt. Die Pflicht zur gesonderten Aufzeichnung der Aufwendungen gilt u. a. auch bei Geschenken, Repräsentationsaufwendungen und „unangemessenen“ Aufwendungen.
4. Einführung der Wirtschafts-Identifikationsnummer
Der Gesetzgeber hat bereits seit langem die Einführung einer Wirtschafts-Identifikationsnummer geplant. Ab November 2024 ist es soweit: Jeder Unternehmer erhält stufenweise ohne Antragstellung eine Wirtschafts-Identifikationsnummer. Diese Nummer soll eine eindeutige Identifizierung des Unternehmers im Besteuerungsverfahren ermöglichen, etwa bei der Umsatzsteuer oder der Grunderwerbsteuer.
Hinweis: Die Wirtschafts-Identifikationsnummer wird vorerst die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nicht ersetzen. Die allgemeine Steuer-Identifikationsnummer, die jeder Bürger erhält, bleibt ebenfalls bestehen, da die Wirtschafts-Identifikationsnummer nur wirtschaftlich tätigen Unternehmern zugeteilt wird.
Übt ein Unternehmer mehrere Tätigkeiten aus, wird die Wirtschafts-Identifikationsnummer durch ein Unterscheidungsmerkmal für jede Tätigkeit ergänzt.
5. Ermäßigung des Steuertarifs bei Umsatzsteuer-Erstattungszinsen
Gute Nachrichten gibt es für Unternehmer, die sich gegen ihren Umsatzsteuerbescheid gerichtlich gewehrt und nach einem jahrelangen Rechtsstreit Recht bekommen haben und neben einer Umsatzsteuererstattung auch Erstattungszinsen zur Umsatzsteuer erhalten. Nach einem Urteil des BFH ist dem Unternehmer nämlich eine Ermäßigung beim steuerlichen Tarif zu gewähren, und zwar nicht nur für die Umsatzsteuererstattung, sondern auch für die Erstattungszinsen. Hierdurch wird die Progression beim Steuersatz deutlich gemindert.
In dem vom BFH entschiedenen Fall erhielt ein Unternehmer nach einem acht Jahre dauernden Rechtsstreit mit dem Finanzamt eine Umsatzsteuererstattung von ca. 320.000 € sowie Erstattungszinsen zur Umsatzsteuer in Höhe von ca. 200.000 €. Der BFH sprach dem Unternehmer die Tarifermäßigung auch für die Erstattungszinsen zu und begründete dies damit, dass Erstattungszinsen eine Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit darstellen – für die Überlassung von Kapital an den Fiskus.
6. Verkürzung von Aufbewahrungsfristen
Die Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege werden verkürzt. Bislang sind Buchungsbelege grundsätzlich zehn Jahre lang aufzubewahren. Diese Aufbewahrungsfrist ist sowohl für die handelsrechtliche als auch für die steuerliche Buchführung sowie für die Umsatzsteuer auf acht Jahre verkürzt worden.
Hinweis: Die Verkürzung der Aufbewahrungsfrist beschränkt sich auf Buchungsbelege, zu denen z. B. Rechnungen, Quittungen, Auftragszettel oder Bankauszüge gehören. Sie gilt nicht für die Bücher, Aufzeichnungen oder Jahresabschlüsse.
Die Neuregelung gilt für Buchungsbelege, deren Aufbewahrungsfrist bis einschließlich zum 31.12.2024 noch nicht abgelaufen ist. Für bestimmte Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche setzt die Verkürzung der Aufbewahrungsfrist dagegen erst ein Jahr später ein.
7. Abschreibungen
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), deren Netto-Anschaffungskosten 800 € nicht übersteigen, können sofort abgeschrieben werden. Sie müssen also nicht über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Typische GWG sind Handys, Stühle, Tische oder Regale.
GWG mit einem (Netto-)Wert über 250 € müssen derzeit in einem gesonderten Verzeichnis aufgeführt werden, sofern die Angaben nicht aus der Buchführung ersichtlich sind. Diese Aufzeichnungs- und Dokumentationspflicht soll nach aktuellen Plänen des Gesetzgebers für Wirtschaftsjahre, die ab dem 1.1.2025 enden, entfallen, im Regelfall also ab dem Wirtschaftsjahr 2025.
Für GWG kann ein sog. Sammelposten gebildet werden, der über fünf Jahre abgeschrieben wird. In den Sammelposten können bislang geringwertige Wirtschaftsgüter aufgenommen werden, deren Netto-Anschaffungskosten höher als 250 € sind und maximal 1.000 € betragen. Der Gesetzgeber plant, die (Netto-)Wertgrenze auf mehr als 800 € bis maximal 5.000 € festzulegen. Außerdem soll die Abschreibungsdauer des Sammelpostens von fünf auf drei Jahre gesenkt werden. Die Neuregelung soll ab 2025 gelten.
Hinweis: Wie bisher muss das Wahlrecht zugunsten eines Sammelpostens für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften, hergestellten oder eingelegten Wirtschaftsgüter einheitlich angewendet werden.
Eine Änderung ist auch bei der degressiven Abschreibung geplant. Nach der bisherigen Rechtslage ist eine degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens möglich, wenn das Wirtschaftsgut entweder bis zum 31.12.2022 angeschafft oder hergestellt oder wenn es nach dem 31.3.2024 und vor dem 1.1.2025 angeschafft oder hergestellt worden ist.
Die degressive Abschreibung ist also zurzeit nicht zulässig, wenn das Wirtschaftsgut nach dem 31.12.2022 und vor dem 1.4.2024 angeschafft oder hergestellt worden ist.
Der Gesetzgeber plant, den zeitlichen Anwendungsbereich der degressiven Abschreibung zu verlängern. Sie soll auch dann in Anspruch genommen werden können, wenn das Wirtschaftsgut vor dem 1.1.2029 angeschafft oder hergestellt wird. Damit wäre die degressive Abschreibung auch für Wirtschaftsgüter möglich, die im Jahr 2025 oder einem Folgejahr angeschafft oder hergestellt werden.
Die Höhe der degressiven Abschreibung hängt davon ab, wann das Wirtschaftsgut angeschafft bzw. hergestellt worden ist:
- Bei Anschaffung oder Herstellung bis zum 31.12.2022 oder – nach der geplanten Neuregelung – nach dem 31.12.2024 und vor dem 1.1.2029 beträgt die degressive Abschreibung das Zweieinhalbfache der linearen Abschreibung, die auf der Nutzungsdauer beruht, maximal aber 25 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
- Bei Anschaffung oder Herstellung nach dem 31.3.2024 und vor dem 1.1.2025 beträgt die degressive Abschreibung das Doppelte der linearen Abschreibung, die auf der Nutzungsdauer beruht, maximal aber 20 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Geplant ist ferner eine neue Sonderabschreibung für Elektro-Fahrzeuge: Die Anschaffungskosten für ein reines Elektro-Fahrzeug sollen über einen Zeitraum von sechs Jahren abgeschrieben werden können. Die Abschreibung soll mit einem Satz von 40 % beginnen und in den Folgejahren auf 24 %, 14 %, 9 %, 7 % und 6 % sinken. Die Neuregelung soll befristet für Anschaffungen im Zeitraum vom 1.7.2024 bis 31.12.2028 gelten.
Hinweis: Das Gesetz, welches die o. g. Änderungen vorsieht, war bei Redaktionsschluss noch nicht verabschiedet. Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir Sie informieren.
Bereits beschlossen wurde die folgende Regelung: Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wie z. B. Maschinen, die ab dem Jahr 2024 angeschafft oder hergestellt worden sind, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Sonderabschreibung von insgesamt 40 % im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung und in den folgenden vier Jahren in Anspruch genommen werden, wenn der Vorjahresgewinn des Unternehmers nicht über 200.000 € betragen hat.
Hinweis: Diese Sonderabschreibung kann zusätzlich zur sog. linearen Abschreibung, die von der Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts abhängig ist, in Anspruch genommen werden.
Für neu gebaute Mietwohnungen, die zum Betriebsvermögen gehören, ist unter bestimmten Voraussetzungen eine degressive Abschreibung von 5 % jährlich zulässig, s. Abschn. IV.1.
8. Option zur Körperschaftsteuer
Personengesellschaften wie z. B. die OHG oder KG, Partnerschaftsgesellschaft oder aber eine eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts können einen Antrag auf Option zur Körperschaftsteuer stellen. Ihr Gewinn wird dann mit einem Körperschaftsteuersatz von 15 % zuzüglich Gewerbesteuer, die bei Körperschaften grundsätzlich anfällt und deren Höhe vom Hebesatz der Gemeinde abhängig ist, besteuert.
Hinweis: Seit 2024 können Gesellschaften bürgerlichen Rechts diesen Antrag stellen, wenn sie im Gesellschaftsregister eingetragen sind. Einzelunternehmer und reine Innengesellschaften wie z. B. die stille Gesellschaft sind von der Option ausgeschlossen.
Grundsätzlich ist die Option bis zum 30.11. zu beantragen, damit sie für das Folgejahr gilt. Der Gesetzgeber hat im Jahr 2024 Erleichterungen ermöglicht: So können neugegründete Personengesellschaften den Antrag innerhalb eines Monats nach Abschluss des Gesellschaftsvertrags stellen, so dass die Option von Beginn der Tätigkeit an gilt. Gleiches gilt für Personengesellschaften, die durch einen umwandlungsrechtlichen Formwechsel aus einer Körperschaft hervorgegangen sind. Sie haben für die Option einen Monat nach Anmeldung des Formwechsels beim Handelsregister Zeit.
Hinweis: Die Option führt zwar grundsätzlich zu einem niedrigeren Steuersatz, sie birgt jedoch auch zahlreiche Risiken – insbesondere, wenn sog. Sonderbetriebsvermögen vorhanden ist (z. B. Grundstücke der Gesellschafter, die an die Personengesellschaft vermietet werden). Hier kann die Option zu einer Besteuerung der stillen Reserven des Sonderbetriebsvermögens führen.
Kommt es zu der Option, wird der Gesellschafter wie ein Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft behandelt und muss künftig Dividenden versteuern. Aufgrund einer ebenfalls im Jahr 2024 erfolgten Gesetzesänderung kommt es jedoch nur dann zu einer Versteuerung einer Dividende, wenn der Gesellschafter den Gewinnanteil tatsächlich entnimmt.
Hinweis: Eine Entnahme sollte möglichst vermieden werden, weil sonst der sich aus der Option ergebende Besteuerungsvorteil entfällt. Zu beachten ist dabei, dass eine Entnahme nicht nur bei einer tatsächlichen Auszahlung an den Gesellschafter vorliegt, sondern auch bei einer Verbuchung des Gewinnanteils auf einem Darlehenskonto des Gesellschafters oder bei einer Verrechnung des Gewinnanteils mit einer Forderung, die die Gesellschaft gegen den Gesellschafter hat.
9. Privatnutzung betrieblicher Fahrzeuge
Die Privatnutzung eines betrieblichen Fahrzeugs muss als Entnahme versteuert werden. Bei einer betrieblichen Nutzung des Fahrzeugs von mehr als 50 % kann die Entnahme nach der sog. 1 %-Methode bewertet werden, d. h. mit 1 % des Bruttolistenpreises (zzgl. Kosten der Sonderausstattung und einschließlich Umsatzsteuer) monatlich.
Bei Elektro- oder Hybridfahrzeugen kommt unter Umständen ein geringerer Entnahmewert in Betracht, und zwar von 0,5 % des Bruttolistenpreises monatlich bei extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bzw. von 0,25 % bei reinen Elektrofahrzeugen. Allerdings darf der Bruttolistenpreis eines reinen Elektrofahrzeugs bislang den Betrag von 70.000 € nicht übersteigen. Der Gesetzgeber plant, diese Grenze auf 95.000 € anzuheben.
Hinweis: Statt des Ansatzes von 1 % bzw. 0,5 % oder 0,25 % pro Monat kann der Unternehmer die Entnahme auch nach der sog. Fahrtenbuchmethode ermitteln, indem er die Privatfahrten anhand eines ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuchs nachweist. Maßgeblich sind dann die auf die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen, in die die Anschaffungskosten für das Kfz eingehen. Die Anschaffungskosten werden unter bestimmten Voraussetzungen bei Hybridelektrofahrzeugen zu 50 % und bei reinen Elektrofahrzeugen nur zu 25 % angesetzt. Bei den Elektrofahrzeugen würde sich die geplante Erhöhung der zulässigen Anschaffungskosten bei reinen Elektrofahrzeugen auf 95.000 € ebenfalls zugunsten des Unternehmers auswirken. Sollte die Regelung nicht umgesetzt werden, werden wir hierüber berichten.
10. Erhöhung der Buchführungsgrenze
Unternehmer, die handelsrechtlich oder nach sonstigen Vorschriften nicht zur Buchführung verpflichtet sind, können vom Finanzamt zur Buchführung aufgefordert werden, wenn bestimmte Umsatz- oder Gewinngrenzen überschritten worden sind. Diese Grenzen sind für Wirtschaftsjahre ab 2024 erhöht worden. Die Umsatzgrenze ist von 600.000 € auf 800.000 € und die Gewinngrenze von 60.000 € auf 80.000 € erhöht worden.
Sind diese Grenzen überschritten worden, fordert das Finanzamt für die Zukunft zur Buchführung auf. Relevant werden kann die Aufforderung zur Buchführung insbesondere für gewerbliche Unternehmer, die keine Kaufleute sind, z. B. Immobilienmakler.
Hinweis: Bei Freiberuflern ist eine Aufforderung zur Buchführung gesetzlich nicht zugelassen.
Handelsrechtlich gilt eine Befreiung von Buchführungs- und Bilanzierungspflicht, wenn bestimmte Umsatz- und Gewinngrenzen nicht überschritten werden. Im Jahr 2024 ist die bisherige Umsatzgrenze ebenfalls von 600.000 € auf 800.000 € und die bisherige Gewinngrenze von 60.000 € auf 80.000 € erhöht worden.
11. Verbesserung der Thesaurierungsbesteuerung
Einzelunternehmen und Personengesellschaften haben die Möglichkeit, die sog. Thesaurierungsbesteuerung zu wählen, so dass der nicht entnommene (thesaurierte) Gewinn statt mit der tariflichen Einkommensteuer mit 28,25 % besteuert wird. Allerdings kommt es zu einer Nachversteuerung mit einem Steuersatz von 25 %, sobald der Gewinn entnommen wird.
Der Gesetzgeber hat die Thesaurierungsbesteuerung ab 2024 verbessert, weil der Thesaurierungssteuersatz nun auch die nicht als Betriebsausgabe abziehbare Gewerbesteuer und die Entnahmen für die Zahlung der Einkommensteuer umfasst.
Hinweis: Die Thesaurierungsbesteuerung kann eine Alternative zur Option zur Körperschaftsteuer sein, s. o. Abschn. 8.
12. Rangrücktrittsvereinbarung
Befindet sich das Unternehmen in einer wirtschaftlich schwierigen Lage, sollte eine Rangrücktrittsvereinbarung mit den Gläubigern in Erwägung gezogen werden. Eine Rangrücktrittsverbindlichkeit muss nämlich nicht in einer Überschuldungsbilanz aufgeführt werden und kann daher geeignet sein, eine Insolvenzantragspflicht zu vermeiden. Eine Rangrücktrittsvereinbarung kommt insbesondere zwischen einer GmbH als Darlehensnehmerin und ihrem Gesellschafter als Darlehensgeber in Betracht.
Hinweis: Bei der Vereinbarung sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass auch eine Tilgung aus freiem bzw. sonstigen Vermögen vereinbart wird. Anderenfalls droht eine gewinnerhöhende Ausbuchung der Verbindlichkeit, die zu einer Steuernachzahlung führen kann.
13. Betriebsausgabenabzug für Geschenke
Die steuerliche Abzugsgrenze für Geschenke an Geschäftsfreunde ist im Jahr 2024 von 35 € auf 50 € angehoben worden. Die Vorsteuer ist ebenfalls abziehbar, wenn die 50 €-Grenze eingehalten wird.
14. Investitionsabzugsbetrag
Unternehmer können prüfen, ob sie für künftige Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 50 % der voraussichtlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gewinnmindernd bilden. Investitionsabzugsbeträge können bis zu einer Summe von 200.000 € pro Betrieb in Anspruch genommen werden. Dies setzt u. a. voraus, dass der Gewinn nicht höher als 200.000 € ist.
15. Rücklage für bestimmte Veräußerungsgewinne
Hat der Unternehmer im Jahr 2024 einen betrieblichen Gewinn aus der Veräußerung von Immobilien (oder Binnenschiffen), die zum Anlagevermögen gehören, erzielt, kann er den Gewinn in eine Rücklage buchen und damit neutralisieren. Die Rücklage ist grundsätzlich innerhalb der folgenden vier Wirtschaftsjahre auf eine neue Immobilie (oder Binnenschiff) zu übertragen und mindert die Abschreibungen. Anderenfalls muss die Rücklage gewinnerhöhend aufgelöst werden und ein sog. Gewinnzuschlag von 6 % für jedes Jahr, in dem die Rücklage gebildet worden war, versteuert werden.
16. Häusliches Arbeitszimmer
Unternehmer können die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer oder eine sog. Tagespauschale für häusliche Büroarbeit steuerlich geltend machen. Zu den Einzelheiten, s. u. Abschn. III. 5.
17. Einlagen einer Mutter-Kapitalgesellschaft
Wird ein Wirtschaftsgut in das Betriebsvermögen eingelegt, wird die Einlage maximal mit den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet, wenn das Wirtschaftsgut innerhalb der letzten drei Jahre vor der Einlage angeschafft oder hergestellt worden ist. Seit dem Jahr 2024 gilt dies nur dann, wenn das Wirtschaftsgut aus dem Privatvermögen eingelegt worden ist. Erfolgt die Einlage hingegen aus dem Betriebsvermögen eines anderen Unternehmens, z. B. aus dem Betriebsvermögen der Mutter-Kapitalgesellschaft, ist der Teilwert anzusetzen. Dies ist der Wert, den ein gedachter Erwerber des gesamten Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut bezahlen würde. Dies führt zu einer Versteuerung der stillen Reserven bei dem einlegenden Unternehmen, z. B. der Mutter-Kapitalgesellschaft.
18. Neues Recht bei Außenprüfungen
Bei der Außenprüfung gibt es zahlreiche Neuregelungen, die grundsätzlich ab 2025 in Kraft treten. Die Neuregelungen gelten für Außenprüfungen, die entweder Steuern betreffen, die nach dem 31.12.2024 entstehen, oder aber Steuern betreffen, die zwar vor dem 1.1.2025 entstehen, für die aber nach dem 31.12.2024 eine Prüfungsanordnung bekanntgegeben worden ist.
Insbesondere soll die Außenprüfung beschleunigt werden. So soll künftig die Prüfungsanordnung bis zum Ablauf des Folgejahres der Bekanntgabe des Steuerbescheids erlassen werden. Ergeht der Steuerbescheid also im Jahr 2025, soll die Außenprüfungsanordnung bis zum 31.12.2026 ergehen.
Außerdem kann das Finanzamt nach Ablauf von sechs Monaten seit Bekanntgabe der Prüfungsanordnung ein sog. qualifiziertes Mitwirkungsverlangen an den Steuerpflichtigen richten, wenn der Unternehmer auf die Möglichkeit eines qualifizierten Mitwirkungsverlangens hingewiesen worden ist und er dennoch seinen Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen ist. Bei Nichtbefolgung des Verlangens kann ein Mitwirkungsverzögerungsgeld von bis zu 11.250 € festgesetzt werden, das bei Konzernen oder in Wiederholungsfällen um einen Zuschlag von bis zu 25.000 € pro Tag der Verzögerung erhöht werden kann.
Verschärft werden auch die Anzeige- und Berichtigungspflichten des Steuerpflichtigen. Berücksichtigt das Finanzamt die Prüfungsfeststellungen in einem Steuerbescheid und wird dieser bestandskräftig, muss der Steuerpflichtige dies dem Finanzamt anzeigen und seine Steuererklärungen für andere Steuerarten oder Veranlagungszeiträume berichtigen, soweit sich der Prüfungssachverhalt auch in anderen Steuererklärungen auswirkt und noch keine Verjährung eingetreten ist.
Hinweis: Des Weiteren soll die Transparenz und Kooperation bei einer Außenprüfung verbessert werden. So kann z. B. das Finanzamt mit dem Steuerpflichtigen vereinbaren, bereits während der Außenprüfung in regelmäßigen Abständen Gespräche über die festgestellten Sachverhalte und steuerlichen Auswirkungen zu führen. Ferner kann das Finanzamt im Einvernehmen mit dem Steuerpflichtigen Rahmenbedingungen für dessen Mitwirkung festlegen, z. B. Fristen vereinbaren oder einen Prüfungsplan erstellen. Hält sich der Steuerpflichtige hieran, darf ein qualifiziertes Mitwirkungsverlangen nicht mehr ergehen.
19. Photovoltaikanlagen
Der Gesetzgeber plant eine Verbesserung der Steuerbefreiung für kleinere Photovoltaikanlagen:
Der Betrieb kleinerer Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von maximal 30 kW (peak) ist steuerfrei. Befinden sich in einem Gebäude mehrere Wohnungen oder Geschäfte, ist bislang eine Bruttoleistung von 15 kW pro Wohn- bzw. Geschäftseinheit zulässig. Diese Grenze von 15 kW soll für Photovoltaikanlagen, die nach dem 31.12.2024 angeschafft, in Betrieb genommen oder erweitert werden, auf 30 kW (peak) je Wohn- oder Gewerbeeinheit erhöht werden. Für vor dem 1.1.2025 angeschaffte Photovoltaikanlagen soll es bei der Grenze von 15 kW pro Wohn- bzw. Geschäftseinheit bleiben, wenn sich in dem Gebäude mehrere Wohnungen oder Geschäfte befinden.
Maximal darf – wie bisher – pro Steuerpflichtigen eine Leistung von 100 kW insgesamt nicht überschritten werden.
Hinweis: Der Gesetzgeber hält daran fest, dass die Steuerbefreiung nur eine Freigrenze ist und kein Freibetrag. Wird also das Größenmerkmal von 100 kW überschritten, fällt für die bisher steuerbefreiten Anlagen die Steuerbefreiung für die Zukunft weg. Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir Sie informieren.
20. Unberechtigter Ausweis von Umsatzsteuer
Nach dem Gesetz muss ein Unternehmer, der in einer Rechnung einen höheren Umsatzsteuerbetrag gesondert ausweist, als er nach dem Gesetz schuldet (z. B. 19 % statt 7 %), den ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag an das Finanzamt abführen, also auch den Mehrbetrag. Die Abführungspflicht gilt nach dem Gesetz auch in den Fällen, in denen ein Nicht-Unternehmer Umsatzsteuer gesondert in Rechnung stellt oder wenn ein Unternehmer eine Rechnung mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer ausstellt, obwohl er gar keine Leistung erbracht hat.
Allerdings hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass die entsprechende europarechtliche Regelung über die Abführungspflicht nicht anzuwenden ist, wenn eine Dienstleistung an einen Endverbraucher erbracht und dabei ein falscher Umsatzsteuersatz ausgewiesen wird. Auf dieses Urteil hat die Finanzverwaltung nun reagiert und wendet die o. g. deutsche Regelung nicht an, wenn die fehlerhafte Rechnung an einen Endverbraucher gerichtet ist oder wenn ein Kleinunternehmer unberechtigt Umsatzsteuer ausweist. In beiden Fällen besteht kein Recht auf Vorsteuerabzug, da Endverbraucher nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind und auch eine Rechnung eines Kleinunternehmers nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, so dass das Steueraufkommen durch die fehlerhafte Rechnung nicht gefährdet wird.
Hinweis: Die Beweislast, dass der Leistungs- und Rechnungsempfänger Endverbraucher ist, liegt beim Rechnungsaussteller.
Wird in einer Gutschrift, die der unternehmerisch tätige Leistungsempfänger einem Nichtunternehmer ausstellt, unberechtigt Umsatzsteuer ausgewiesen, soll nach einem Gesetzesvorhaben künftig der Gutschriftempfänger verpflichtet sein, die zu Unrecht ausgewiesene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen. Der BFH hatte dies bislang verneint.
21. Umsatzsteuersatz bei Nebenleistungen eines Hotels
Der EuGH muss die Frage klären, ob der ermäßigte Umsatzsteuersatz auch für Nebenleistungen des Hotels gilt oder ob die Nebenleistung dem regulären Steuersatz unterliegt, so dass der Gesamtübernachtungspreis aufzuteilen ist. Der BFH hat an den EuGH drei entsprechende Vorabentscheidungsersuchen gerichtet, so dass der Ausgang der Verfahren abzuwarten ist und entsprechende Umsatzsteuerfestsetzungen offen gehalten werden sollten.
Es geht um Nebenleistungen eines Hotels, die in den Streitfällen weder hinzugebucht noch abgewählt werden konnten, sondern zwingend im Übernachtungspreis enthalten waren (Hotelparkplatz, Frühstück, Fitnessbereich, Wellnessbereich, WLAN). Nach deutschem Recht müsste der Gesamtpreis aufgeteilt werden in einen Übernachtungspreis für das Zimmer, der dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegt, und in einen Preis für die im Gesamtpreis enthaltenen Nebenleistungen wie z. B. das Frühstück, den Parkplatz, den Wellness- und Fitnessbereich etc., die dem regulären Umsatzsteuersatz von 19 % unterliegen. Der BFH hält es allerdings für denkbar, dass nach der Rechtsprechung des EuGH keine Aufteilung vorzunehmen ist, so dass der Gesamtpreis dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegt, weil die ermäßigt besteuerte Übernachtung die Hauptleistung darstellt.
Hinweis: Ist die weitere Leistung, die zusätzlich zur Übernachtung erbracht wird, eigenständig buchbar, so dass sie zu- oder abgewählt werden kann, handelt es sich nicht um eine Nebenleistung, sondern um eine eigenständige Leistung, die dem regulären Steuersatz von 19 % unterliegt.
Unabhängig davon können sich Hoteliers und deren Gäste über den Wegfall der Hotelmeldepflicht für deutsche Staatsangehörige freuen. Ab dem 1.1.2025 entfällt weitgehend die Vorgabe, für Übernachtungen deutscher Staatsangehöriger Meldescheine auszufüllen. Ausländer unterliegen dagegen weiterhin der Meldepflicht.
22. Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands zum Unternehmen
Die Finanzverwaltung akzeptiert grundsätzlich die neue Rechtsprechung des BFH sowie des EuGH zur umsatzsteuerlichen Zuordnung gemischt-genutzter Gegenstände zum Unternehmen, die einen Vorsteuerabzug ermöglicht. Danach genügt es, wenn der Unternehmer seine Zuordnungsentscheidung innerhalb der Dokumentationsfrist dokumentiert. Die Dokumentationsfrist endet grundsätzlich mit der Abgabefrist für die Umsatzsteuererklärung, unabhängig davon, ob der Unternehmer durch einen Steuerberater vertreten wird, also am 31.7. des Folgejahres (s. jedoch Hinweis unten).
Die Dokumentation selbst erfolgt in der Regel durch die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs. Alternativ kann der Unternehmer auch mit Hilfe anderer Beweisanzeichen, die nach außen hin objektiv erkennbar sind, darlegen, dass er den Gegenstand, der sowohl unternehmerisch als auch nichtunternehmerisch genutzt wird, vollständig dem Unternehmen zuordnet, z. B. durch den Abschluss von Verträgen, um mit dem Gegenstand Ausgangsumsätze zu erzielen oder aus dem Abschluss einer betrieblichen Versicherung.
Damit ist es auch nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht mehr erforderlich, dass der Unternehmer bis zum Ende der gesetzlichen Abgabefrist für die Umsatzsteuererklärung dem Finanzamt seine Entscheidung, den gemischt-genutzten Gegenstand ganz oder teilweise dem Unternehmen zuzuordnen, mitteilt. Es genügt, wenn er die Dokumentation fristgerecht vornimmt und diese dem Finanzamt zu einem späteren Zeitpunkt auf Aufforderung vorlegen kann.
Hinweis: Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob die Dokumentationsfrist für steuerlich vertretene Unternehmer bereits mit der Abgabefrist für steuerlich nicht vertretene Unternehmer (grundsätzlich der 31.7. des Folgejahres) endet oder ob sie erst mit dem Ablauf der Abgabefrist für steuerlich beratene Unternehmer (grundsätzlich mit Ablauf des 28.2. bzw. 29.2. des übernächsten Jahres) endet. Das FG Köln geht bei steuerlich vertretenen Unternehmern von einer entsprechend längeren Dokumentationsfrist aus, weil diese nicht kürzer sein darf als die Frist für die Abgabe der Umsatzsteuererklärung. Eine BFH-Entscheidung hierzu steht noch aus.
23. Vorsteuerabzug aus der Rechnung eines sog. Ist-Versteuerers
Bislang ist der Vorsteuerabzug möglich, wenn die Leistung erbracht worden ist und eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des EuGH ist dieser Grundsatz jedoch ins Wanken geraten, soweit es um den Vorsteuerabzug aus der Rechnung eines sog. Ist-Versteuerers geht, der die Umsatzsteuer erst dann an das Finanzamt abführen muss, wenn er von seinem Vertragspartner das Entgelt erhalten hat. Der EuGH knüpft den Vorsteuerabzug nämlich zusätzlich an die Bezahlung der Rechnung.
Der Gesetzgeber will nun auf die EuGH-Rechtsprechung reagieren und den Vorsteuerabzug aus einer ordnungsgemäßen Rechnung eines Ist-Versteuerers erst dann zulassen, wenn der Leistungsempfänger an den leistenden Ist-Versteuerer zahlt.
Die Neuregelung soll erstmals für Rechnungen gelten, die nach dem 31.12.2027 ausgestellt werden. Bis dahin bleibt es dabei, dass ein Vorsteuerabzug möglich ist, wenn die Leistung erbracht worden ist und eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt.
Hinweis: Der leistende Ist-Versteuerer soll ab 2028 dazu verpflichtet werden, in seiner Rechnung darauf hinzuweisen, dass er die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten berechnet. Auf diese Weise soll der Rechnungsempfänger davon erfahren, dass er die Vorsteuer erst geltend machen kann, wenn er die Rechnung bezahlt. Sollten sich an den geplanten Regelungen Änderungen ergeben, werden wir Sie hierüber informieren.
24. Einführung der elektronischen Rechnung im B2B Bereich
Grundsätzlich besteht ab 1.1.2025 die Pflicht, bei Leistungen an andere Unternehmer im Inland eine elektronische Rechnung auszustellen. Damit ist nicht die elektronische Übermittlung per E-Mail gemeint, sondern die Erstellung einer Rechnung in einem sog. strukturierten elektronischen Format, das elektronisch ausgewertet und in einem europäischen Meldesystem erfasst werden kann. Ausgenommen von der E-Rechnungspflicht sind Rechnungen über bestimmte steuerfreie Leistungen, Kleinbetragsrechnungen bis 250 € sowie Fahrausweise.
Für die Einführung der E-Rechnung sind bestimmte Übergangsregelungen vorgesehen. Bis zum 31.12.2026 kann der Unternehmer wie bisher die Rechnung in Papierform oder per E-Mail mit Rechnungsanhang ausstellen und übermitteln. Es gilt zudem für Umsätze des Jahres 2027 eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2027, wenn sich der Umsatz des rechnungsausstellenden Unternehmers im Vorjahr 2026 auf maximal 800.000 € belief. Ab dem 1.1.2028 gilt die Pflicht zur Ausstellung und Übermittlung von E-Rechnungen für B2B-Umsätze im Inland für alle inländischen Unternehmen.
Hinweise: Unabhängig von den o. g. Übergangsfristen ist der Unternehmer in jedem Fall ab dem 1.1.2025 zum Empfang einer elektronischen Rechnung verpflichtet. Für den Rechnungsempfang gelten die Übergangsregelungen also nicht. Rechnungen an Privatpersonen können auch weiterhin in Papierform oder per E-Mail mit Rechnungsanhang übermittelt werden.
25. Kleinunternehmer
Seit 2024 sind Kleinunternehmer grundsätzlich nicht mehr zur Abgabe einer Umsatzsteuer-Jahreserklärung verpflichtet, können aber vom Finanzamt zur Abgabe einer Umsatzsteuer-Jahreserklärung aufgefordert werden.
Der Gesetzgeber plant, die Umsatzgrenzen für Kleinunternehmer ab 2025 anzuheben. Bislang ist ein Unternehmer dann Kleinunternehmer, wenn sein Umsatz im Vorjahr 22.000 € nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50.000 € voraussichtlich nicht übersteigen wird. Künftig soll der Kleinunternehmerstatus gelten, wenn der Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 25.000 € nicht überschritten hat und im laufenden Kalenderjahr 100.000 € tatsächlich nicht überschreitet. Wird der Grenzwert von 100.000 € im laufenden Kalenderjahr überschritten, kommt eine weitere Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in Betracht.
Ein Kleinunternehmer muss keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen, kann aber auch keine Vorsteuer geltend machen. Der Unternehmer kann auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung verzichten und wird dann wie ein „regulärer“ Unternehmer behandelt, der Umsatzsteuer in Rechnung stellen und abführen muss, im Gegenzug aber auch Vorsteuer abziehen kann. Der Verzicht bindet den Unternehmer für mindestens fünf Kalenderjahre.
Ab 2025 soll die Kleinunternehmerregelung wechselseitig auch in anderen EU-Staaten gelten können. So soll z. B. ein Unternehmer aus Deutschland die Kleinunternehmerregelung in einem anderen EU-Staat in Anspruch nehmen können, wenn sein Umsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 100.000 € nicht überschritten hat und im laufenden Kalenderjahr nicht überschreitet. In diesem Fall muss er an einem besonderen Meldeverfahren für Kleinunternehmer teilnehmen, wofür er vom Bundeszentralamt für Steuern eine Kleinunternehmer-Identifikationsnummer erhält. Außerdem muss er die Voraussetzungen des anderen EU-Staates für Kleinunternehmer erfüllen. Nach Durchführung des Meldeverfahrens muss der Unternehmer für jedes Kalendervierteljahr eine Umsatzmeldung beim Bundeszentralamt für Steuern abgeben, damit die Einhaltung der Umsatzgrenze überprüft werden kann.
Hinweis: Entsprechend soll auch ein in einem anderen EU-Staat ansässiger Unternehmer die Kleinunternehmerregelung in Deutschland ab 2025 in Anspruch nehmen können. Auch hier darf der Umsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 100.000 € nicht überschritten haben und 100.000 € im laufenden Kalenderjahr nicht überschreiten.
Darüber hinaus sollen Kleinunternehmer von der Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung (s. vorheriger Beitrag) befreit werden. Zum Empfang sollen sie allerdings in der Lage sein müssen.
Sofern sich an den geplanten Regelungen Änderungen ergeben, werden wir Sie informieren.
26. Durchschnittssteuersatz für Forst- und Landwirte
Landwirte, deren Umsatz im Vorjahr 600.000 € nicht überschritten hat, können die sog. Durchschnittssatzbesteuerung anwenden, bei der eine durchschnittliche Umsatzsteuer und eine gleich hohe Vorsteuer festgesetzt wird. Für Landwirte soll der Durchschnittssteuersatz noch im Jahr 2024 von 9 % auf 8,4 % und ab 2025 von 8,4 % auf 7,8 % gesenkt werden.
27. Innerorganschaftliche Umsätze
Bei einer umsatzsteuerlichen Organschaft, die zwischen einem Organträger und einen oder mehreren Organgesellschaften besteht, sind die Leistungen, die die Mitglieder der Organschaft untereinander erbringen, nicht umsatzsteuerbar, so dass keine Umsatzsteuer anfällt. Dies hat der EuGH jüngst entschieden und damit eine Rechtsunsicherheit, die aufgrund einer vorherigen Entscheidung des EuGH entstanden war, beseitigt.
28. Erhöhung der Schwellenwerte für Umsatzsteuervoranmeldungen
Nach derzeitigem Recht müssen Unternehmer eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, sofern die Umsatzsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr mehr als 7.500 € betragen hat. Dieser Schwellenwert wird ab 2025 auf 9.000 € erhöht, sodass künftig mehr Unternehmer nur noch vierteljährlich eine Voranmeldung abgeben müssen. Ebenfalls auf 9.000 € angehoben wird der Schwellenwert für diejenigen, die von der vierteljährlichen zur monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung wechseln möchten, um mögliche Umsatzsteuererstattungen so schnell wie möglich zu erhalten. Voraussetzung hierfür war bisher, dass sich im vorangegangenen Kalenderjahr ein Überschuss von mehr als 7.500 € ergibt.
Hat die Vorjahressteuer nicht mehr als 1.000 € betragen, kann der Unternehmer ganz von der Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen befreit werden. Auch dieser Schwellenwert wird ab 2025 auf 2.000 € erhöht, so dass dann nur noch eine jährliche Umsatzsteuerjahreserklärung abgegeben werden muss.
29. Erweiterte Gewerbesteuerkürzung bei Verkauf von Betriebsvorrichtungen
Unternehmen, die nur aufgrund ihrer Rechtsform als Kapitalgesellschaft oder aufgrund ihrer gewerblichen Prägung als GmbH & Co. KG gewerbesteuerpflichtig sind, tatsächlich aber ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen, können eine sog. erweiterte Gewerbesteuerkürzung beantragen. Der Ertrag aus der Grundstücksverwaltung und -nutzung unterliegt dann nicht der Gewerbesteuer.
Die erweiterte Kürzung ist jedoch gefährdet, wenn die Vermietungsgesellschaft auch bewegliche Wirtschaftsgüter wie Betriebsvorrichtungen (z. B. Lastenfahrstühle, Küchenaufzüge, Belüftungsanlagen in Hotels) mitvermietet. Nach aktueller Rechtslage ist die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen nur dann gewerbesteuerlich unschädlich, wenn die Einnahmen hieraus 5 % der Mieteinnahmen nicht überschreiten.
Statt einer Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen kann die Vermietungsgesellschaft in Erwägung ziehen, die Betriebsvorrichtungen an den Mieter zu verkaufen. Allerdings hat der BFH in einer aktuellen Entscheidung deutlich gemacht, dass ein solcher Verkauf nur dann steuerlich akzeptiert wird, wenn die Betriebsvorrichtungen keine wesentlichen Bestandteile des bebauten Grundstücks sind. Wesentliche Bestandteile sind Sachen, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird.
Hinweis: Handelt es sich bei den Betriebsvorrichtungen nicht um wesentliche Bestandteile, kann auch ein nachträglicher Verkauf an den Mieter in Betracht gezogen werden, damit jedenfalls ab diesem Zeitpunkt die erweiterte Gewerbesteuerkürzung möglich ist. Allerdings müsste dann auch der Mietvertrag entsprechend angepasst werden, weil anderenfalls ein steuerlich unzulässiges Scheingeschäft vorliegen könnte.
30. Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mieten
Bei der Gewerbesteuer wird die Hälfte der Grundstücksmiete dem Gewinn hinzugerechnet, wenn das Grundstück zum Anlagevermögen und nicht zum Umlaufvermögen gehören würde. Dem BFH zufolge gilt die Hinzurechnungspflicht auch für Mietaufwendungen eines Imbissbetreibers, der seinen Imbiss auf wechselnden Standplätzen auf Jahrmärkten betreibt und hierfür Standmieten zahlen muss. Der BFH hält es für unbeachtlich, dass die Mietdauer jeweils nur wenige Tage oder wenige Wochen pro Jahrmarkt beträgt.
Eine Hinzurechnung bei der Gewerbesteuer unterbleibt, wenn die Zahlungen nicht auf einem Mietvertrag beruhen, sondern auf einem Vertrag eigener Art oder auf einen Vertrag, der wesentliche mietfremde Elemente wie z. B. Reinigung, Transport oder andere Dienstleistungen enthält. Außerdem scheidet eine Hinzurechnung aus, wenn die Mieten als Herstellungskosten zu aktivieren sind und damit den Gewinn nicht gemindert haben.
Hinweis: Bei der Hinzurechnung von Mieten, Lizenzaufwendungen und Zinsen wird ein Freibetrag von 200.000 € pro Gewerbebetrieb gewährt.
II. Kapitalgesellschaften und ihre Gesellschafter
1. Option eines GmbH-Gesellschafters zum Teileinkünfteverfahren
Gute Nachrichten gibt es für GmbH-Gesellschafter, die sich hinsichtlich ihrer Dividenden und Finanzierungsaufwendungen gegen die Abgeltungsteuer und für das sog. Teileinkünfteverfahren entscheiden wollen.
Zwar ist die Abgeltungsteuer mit einem Steuersatz von 25 % recht günstig. Jedoch ist ein Abzug von Aufwendungen, z. B. von Zinsen für einen Kredit, mit dem die GmbH-Beteiligung erworben wurde, nach dem Gesetz ausgeschlossen. Allerdings können GmbH-Gesellschafter, die mit mindestens 1 % an der GmbH beteiligt und für die GmbH in einer unternehmerisch relevanten Weise beruflich tätig oder zu mindestens 25 % an der GmbH beteiligt sind, zum Teileinkünfteverfahren optieren, so dass die Dividenden zu 60 % steuerpflichtig sind und Werbungskosten im Umfang von 60 % abgezogen werden können. Für die sich danach ergebenden Einkünfte gilt dann nicht die Abgeltungsteuer, sondern der individuelle Steuersatz. Der Antrag gilt nach dem Gesetz auch für die folgenden vier Veranlagungszeiträume, ohne dass die Antragsvoraussetzungen erneut zu belegen sind.
Der BFH hat nun der Auffassung der Finanzverwaltung widersprochen und entschieden, dass die Voraussetzungen für diese Option nur in dem Jahr, für das erstmals die Option gestellt wird, vorliegen müssen. In den folgenden vier Veranlagungszeiträumen sind die Voraussetzungen dann zu unterstellen und müssen nicht mehr erfüllt sein.
Beispiel: Ist der Gesellschafter in dem Jahr, für das er erstmals die Option auf Anwendung des Teileinkünfteverfahrens beantragt, mit mindestens 1 % beteiligt und als Prokurist tätig und beendet er im Folgejahr seine Tätigkeit als Prokurist, bleibt die Option auch ab dem Folgejahr bis einschließlich dem vierten Folgejahr wirksam.
2. Verlustuntergang bei Anteilsübertragung von mehr als 50 %
Nach wie vor steht eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) über die Verfassungsmäßigkeit der Regelung über den Verlustuntergang bei Kapitalgesellschaften bei einer Anteilsübertragung von mehr als 50 % der Anteile aus.
Im Gegensatz dazu hat sich der BFH zum Umfang des Verlustuntergangs geäußert, wenn die Kapitalgesellschaft an einer KG beteiligt ist und für die Kapitalgesellschaft ein verrechenbarer Verlust festgestellt worden ist. Dem BFH zufolge geht der verrechenbare Verlust nicht unter, sondern bleibt trotz der mehr als 50%igen Anteilsübertragung an der Kapitalgesellschaft erhalten.
Bis zu einer Entscheidung des BVerfG bleibt unsicher, ob die Verlustuntergangsregelung überhaupt verfassungskonform ist. Wer die Entscheidung des BVerfG nicht abwarten möchte, sondern vorher eine Anteilsübertragung von mehr als 50 % plant, sollte prüfen, ob er den Verlustuntergang mittels einer der gesetzlichen Ausnahmen verhindern oder zumindest abmildern kann: Zu diesen Ausnahmen gehört die sog. Konzernklausel, nach der eine Anteilsübertragung innerhalb eines Konzerns unschädlich ist. Ferner kommt die sog. Verschonungsregelung in Betracht, nach der ein Verlustuntergang vermieden wird, soweit stille Reserven in der Kapitalgesellschaft vorhanden sind. Außerdem scheidet ein Verlustuntergang bei einer Anteilsübertragung zwecks Sanierung unter bestimmten Voraussetzungen aus. Sofern keine dieser Ausnahmen greift, könnte ein Antrag auf Feststellung eines sog. fortführungsgebundenen Verlustvortrags gestellt werden. Falls dieser Antrag, der an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist und insbesondere die Fortführung des Betriebs verlangt, Erfolg hat, bleibt der Verlust erhalten und kann mit künftigen Gewinnen verrechnet werden. Jedoch kann ein fortführungsgebundener Verlustvortrag aufgrund eines sog. schädlichen Ereignisses untergehen, z. B. bei der Einstellung des Betriebs oder bei der Beteiligung an einer unternehmerisch tätigen Personengesellschaft, sofern keine ausreichend hohen stillen Reserven vorhanden sind.
3. Fiktiver Zufluss einer nicht ausgezahlten Tantieme
Bei einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer, der eine Tantiemevereinbarung mit der GmbH abgeschlossen hat, kann eine noch nicht ausgezahlte Tantieme als zugeflossen gelten und muss dann bereits vor dem Zufluss vom Gesellschafter-Geschäftsführer versteuert werden.
Zu einem fiktiven Zufluss kommt es, wenn der Tantiemeanspruch fällig und durchsetzbar ist Denn dann kann ein beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer die Auszahlung der Tantieme durchsetzen. Der BFH hat diesen Grundsatz jüngst eingeschränkt und damit der Finanzverwaltung widersprochen: Ein fiktiver Zufluss beim beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer setzt neben der Fälligkeit und Durchsetzbarkeit auch noch voraus, dass die GmbH in ihrem Jahresabschluss eine entsprechende Tantiemeverpflichtung passiviert hat. Der Tantiemeanspruch knüpft nämlich in der Regel an die Feststellung des Jahresabschlusses an, so dass im Jahresabschluss die Tantiemeverpflichtung ausgewiesen sein muss.
Hinweis: Zu einem Zufluss eines Tantiemeanspruchs kann es ebenfalls kommen, wenn ein Gesellschafter-Geschäftsführer – unabhängig von seiner beherrschenden Stellung – auf seinen bereits entstandenen Tantiemeanspruch verzichtet. Kein Zufluss ist dagegen anzunehmen, wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer lediglich für die Zukunft auf seine Tantieme verzichtet und die Tantiemevereinbarung für künftige Zeiträume aufgehoben wird.
4. Vermeidung von Streubesitzbeteiligungen bei Mutter-Kapitalgesellschaften
Erhält eine Mutter-Kapitalgesellschaft von ihrer Tochter-Kapitalgesellschaft Dividenden, sind diese bei der Mutter-Kapitalgesellschaft grundsätzlich zu 95 % steuerfrei. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Mutter-Kapitalgesellschaft mit weniger als 10 % beteiligt ist; die Dividenden sind dann als sog. Streubesitzdividenden in vollem Umfang steuerpflichtig.
Das Gesetz sieht die Möglichkeit vor, durch einen Hinzuerwerb einer Beteiligung von mindestens 10 % während des Wirtschaftsjahres die 10 %-Grenze rückwirkend zum 1.1. des Jahres zu erreichen; die Dividenden sind dann zu 95 % steuerfrei. Der BFH hat diese Möglichkeit nun gestützt: Der Hinzuerwerb muss nicht „auf einen Schlag“ erfolgen, sondern es genügt ein sog. Blockerwerb, durch den in einem wirtschaftlich einheitlichen Erwerbsvorgang unterjährig Anteile von mehreren Veräußerern erworben und hierdurch die Beteiligungsschwelle von insgesamt mindestens 10 % erreicht wird. Dies ist der Fall, wenn die weiteren Hinzuerwerbe in einer einzigen notariellen Urkunde beurkundet werden.
Beispiel: Die M-GmbH ist an der T-GmbH am 1.1.2024 zu 5 % beteiligt. Weitere Gesellschafter sind A und B. Am 1.8.2024 erwirbt die M-GmbH von A und B jeweils 3 %; die beiden Käufe erfolgen in einer gemeinsamen notariellen Urkunde. Es liegt damit ein wirtschaftlich einheitlicher Erwerbsvorgang vor, so dass die M-GmbH vom 1.1.2024 an als mit 11 % – und damit mit mindestens 10 % – an der T-GmbH beteiligt gilt.
Unproblematisch ist der Fall, wenn die Mutter-GmbH nur einen einzigen Anteilskauf während des Jahres im Umfang von mindestens 10 % tätigt. Hier besteht ebenfalls vom 1.1. an eine Mindestbeteiligung von 10 %, so dass die Dividenden zu 95 % steuerfrei sind.
5. Option zur Körperschaftsteuer
Personengesellschaften können zur Körperschaftsteuer optieren, s. o. Abschn. I. 8.
6. Allgemeine Hinweise zu Kapitalgesellschaften
Die vertraglichen Beziehungen zwischen der Kapitalgesellschaft und ihren Gesellschaftern sollten regelmäßig auf ihre Fremdüblichkeit, insbesondere Angemessenheit, und tatsächliche Durchführung hin überprüft werden, um eine verdeckte Gewinnausschüttung zu vermeiden. Dies gilt etwa für Geschäftsführer-, Miet- oder Darlehensverträge, aber auch für die Verzinsung eines Verrechnungskontos.
7. Geplante Änderungen bei der Gemeinnützigkeit
Änderungen sind im Bereich der steuerlichen Gemeinnützigkeit geplant. So soll ab 2025 die Vermietung an bedürftige Mieter, deren Bezüge nicht höher sind als das Fünffache des Sozialhilferegelsatzes bzw. – bei Alleinstehenden oder Alleinerziehern – als das Sechsfache des Regelsatzes, als gemeinnützig ausgestaltet werden. Die Miete muss zu Beginn des Mietvertrags oder auch nach einer Mieterhöhung dauerhaft unter der marktüblichen Miete liegen. Ausreichen soll es auch, wenn die jeweilige Wohnung zu einem Mietzins vermietet wird, der nur die tatsächlichen Aufwendungen einschließlich der regulären Absetzung für Abnutzung deckt und keinen Gewinnaufschlag enthält. Ergeben sich aus der Vermietung an bedürftige Mieter Verluste, können diese durch Einnahmen aus dem ideellen (gemeinnützigen) Bereich ausgeglichen werden. Sollten sich an der geplanten Regelung Änderungen ergeben, werden wir Sie informieren.
III. Arbeitgeber/Arbeitnehmer
1. Doppelte Haushaltsführung
Bei einer doppelten Haushaltsführung können die Kosten der Unterkunft am Beschäftigungsort nur bis zu 1.000 € monatlich als Werbungskosten abgezogen werden. Dem BFH zufolge gehört die Zweitwohnungsteuer, die der Arbeitnehmer für seine Zweitwohnung am Beschäftigungsort zahlen muss, zu den Kosten der Unterkunft. Daher kann sie nur dann als Werbungskosten abgezogen werden, wenn sie zusammen mit der Miete die steuerliche Abzugsgrenze von 1.000 € monatlich für Unterkunftskosten nicht übersteigt.
Hinweise: Andere Kosten der doppelten Haushaltsführung wie z. B. Fahrtkosten oder Kosten für die Einrichtung der Zweitwohnung werden von der gesetzlichen Abzugsbeschränkung für Unterkunftskosten dagegen nicht erfasst.
Die Beschränkung des Werbungskostenabzugs auf 1.000 € im Monat gilt nur für Zweitwohnungen im Inland, nicht aber für Zweitwohnungen im Ausland. Dem BFH zufolge ist der Werbungskostenabzug für die Zweitwohnung daher in der Höhe zulässig, in der die Kosten für die Zweitwohnung notwendig sind. Die Notwendigkeit kann z. B. zu bejahen sein, wenn der Arbeitgeber die Zweitwohnung dem Arbeitnehmer verbilligt zuweist.
2. Abzug von Rechtsanwaltskosten
Aufwendungen eines Arbeitnehmers für einen Rechtsanwalt, der ihn in einem beruflich veranlassten Verfahren vertritt, können als Werbungskosten abziehbar sein. So hat der BFH den Abzug von Rechtsanwaltskosten, die ein Berufssoldat aufgrund eines Wehrdisziplinarverfahrens getragen hat, als Werbungskosten zugelassen. Das Wehrdisziplinarverfahren ist beruflich veranlasst, da es wegen einer dienstlichen Verfehlung geführt wird und dem Betroffenen dienstliche Nachteile wie z. B. eine Gehaltskürzung, ein Beförderungsverbot, die Herabsetzung in der Besoldungsgruppe, eine Dienstgradherabsetzung oder sogar die Entfernung aus dem Dienst drohen.
Dem FG Düsseldorf zufolge kann ein Geschäftsführer die Rechtsanwaltskosten für ein Strafverfahren, das gegen ihn wegen Untreueverdachts zu Lasten seines Arbeitgebers geführt wird, als Werbungskosten absetzen, wenn sich der Untreueverdacht nicht bestätigt. Der berufliche Zusammenhang der Rechtsanwaltskosten folgt aus der Tätigkeit als Geschäftsführer. Wenn sich der Verdacht nicht bestätigt, der Geschäftsführer also keine Untreue begangen hat, kann ihm keine private Bereicherung und damit auch keine private Veranlassung vorgehalten werden.
3. Betriebsveranstaltungen
Führt die Teilnahme an einer Betriebsveranstaltung zu steuerpflichtigem Arbeitslohn, kann der Arbeitgeber den Arbeitslohn pauschal mit 25 % versteuern. Für die Anwendung der Pauschalsteuer ist es dem BFH zufolge nicht erforderlich, dass die Betriebsveranstaltung allen Arbeitnehmern offen gestanden hat. Vielmehr genügt es, dass es sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter handelt. Diese Veranstaltung kann dann z. B. auch nur für die Führungsebene gedacht sein.
Hinweis: Durch die Pauschalierung entfällt insoweit die Sozialversicherungspflicht.
Der Freibetrag von 110 € pro Arbeitnehmer wird allerdings nur gewährt, wenn die Veranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht.
4. Dienstwagen
Darf der Arbeitnehmer einen Dienstwagen auch privat nutzen, führt dies zu einem steuerpflichtigen geldwerten Vorteil. Der geldwerte Vorteil wird grundsätzlich nach der sog. 1 %-Methode ermittelt, so dass monatlich 1 % des Bruttolistenpreises zuzüglich der Sonderausstattung des Fahrzeugs als steuerpflichtiger Vorteil angesetzt wird. Für Elektro- und Hybridfahrzeuge gelten günstigere Regelungen (s. o. Abschn. I. 9.).
Der Arbeitnehmer kann auch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch führen, so dass dann nur die auf seine Privatfahrten entfallenden Aufwendungen zu versteuern sind (sog. Fahrtenbuchmethode). Bei einem elektronischen Fahrtenbuch ist die Ordnungsmäßigkeit dem FG Düsseldorf zufolge zu verneinen, wenn nachträgliche Veränderungen in dem elektronischen Fahrtenbuch nicht in der Fahrtenbuchdatei selbst, sondern nur in einer externen Protokolldatei dokumentiert werden, und wenn die Eintragungen nicht zeitnah, sondern erst nach jedem Tankvorgang vorgenommen werden, so dass bis zu drei Wochen Zeit vergehen. Die Ordnungsmäßigkeit eines elektronischen Fahrtenbuchs setzt voraus, dass nachträgliche Veränderungen entweder technisch ausgeschlossen sind oder aber in der Datei selbst dokumentiert bzw. offengelegt werden, damit sie bei gewöhnlicher Einsichtnahme in das elektronische Fahrtenbuch sogleich erkennbar sind.
5. Häusliches Arbeitszimmer
Arbeitnehmer, die auch im Home-Office arbeiten, sollten prüfen, ob sie Werbungskosten für ihre häusliche Tätigkeit geltend machen können, z. B. die Kosten für ein Arbeitszimmer oder aber die sog. Tagespauschale: Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer können entweder in tatsächlicher Höhe oder aber pauschal in Höhe von 1.260 € als Werbungskosten abgezogen werden, wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet.
Liegen die Voraussetzungen für ein häusliches Arbeitszimmer nicht vor, weil der Arbeitnehmer z. B. eine Arbeitsecke im Wohn- oder Schlafzimmer nutzt, kann er die sog. Tagespauschale von 6 € pro Tag, maximal 1.260 € im Jahr, geltend machen. Der Arbeitnehmer erhält die Tagespauschale für jeden Tag, an dem er seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit überwiegend in der Wohnung ausübt und nicht in den Betrieb (d. h. zur ersten Tätigkeitsstätte) fährt. Eine Fahrt in den Betrieb oder auch eine auswärtige Tätigkeit ist jedoch unschädlich, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.
6. Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers
Die unentgeltliche oder verbilligte Übertragung von Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers führt zu Arbeitslohn, der zu versteuern ist. Um die Wirkung der Besteuerung abzumildern, sieht das Gesetz einen Besteuerungsaufschub vor. Dieser Besteuerungsaufschub soll rückwirkend ab dem 1.1.2024 auch auf die Übertragung von Anteilen an Konzernunternehmen angewendet werden können.
Der Konzern darf allerdings bestimmte Schwellenwerte nicht überschreiten, und das Konzernunternehmen muss innerhalb der letzten 20 Jahre gegründet worden sein. Sollten sich an den geplanten Regelungen Änderungen ergeben, werden wir hierüber berichten.
7. Inflationsausgleichsprämie
Im Zeitraum vom 26.10.2022 bis zum 31.12.2024 kann der Arbeitgeber eine sog. Inflationsausgleichsprämie bis zur Höhe von 3.000 € steuerfrei zahlen, wenn sie zusätzlich zum Arbeitslohn erbracht wird. Soweit dieser Betrag bislang nicht ausgeschöpft worden ist, kann die Prämie noch bis zum 31.12.2024 gezahlt werden.
8. Mindestlohn und Minijobs
Ab dem 1.1.2025 wird der allgemeine gesetzliche Mindestlohn in Deutschland steigen, und zwar von 12,41 € auf 12,82 €. Damit erhöht sich auch die hieran gekoppelte Minijob-Grenze von 538 €/Monat auf 556 € (Jahresverdienstgrenze: 6.672 €).
Hinweis: Die Anpassung des Mindestlohns lässt laufende Tarifverträge im Wesentlichen unberührt. Der Mindestlohn gilt darüber hinaus u. a. nicht für Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz, Pflichtpraktikanten im Rahmen einer Schul-, Hochschulausbildung oder eines Freiwilligendienstes, Absolventen eines freiwilligen Praktikums bis zu drei Monaten, Personen, die einen freiwilligen Dienst ableisten und grundsätzlich auch nicht für ehrenamtlich Tätige.
IV. Vermieter
1. Abschreibungen auf Gebäude
Der Abschreibungssatz für vermietete Gebäude im Privatvermögen beträgt grundsätzlich 3 %, wenn das Gebäude nach dem 31.12.2022 fertiggestellt worden ist, für zuvor fertiggestellte Gebäude 2 % (bzw. 2,5 % bei historischen Gebäuden mit Fertigstellung vor dem 1.1.1925).
Der Steuerpflichtige kann auch eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes zu Grunde legen und damit eine höhere Abschreibung in Anspruch nehmen. Dem BFH zufolge ist der entsprechende Nachweis durch ein Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zu führen. Inhaltlich muss sich der Gutachter zu den maßgeblichen Kriterien der Nutzungsdauer äußern, z. B. zum technischen Verschleiß, der wirtschaftlichen Entwertung oder zu rechtlichen Nutzungsbeschränkungen.
Daneben kann der Steuerpflichtige für neu gebaute oder angeschaffte Mietwohnungen eine Sonderabschreibung von bis zu 5 % jährlich in den ersten vier Jahren (insgesamt also bis zu 20 %) zusätzlich zur regulären Abschreibung von 3 % in Anspruch nehmen. Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung ist auf 4.000 € pro Quadratmeter beschränkt.
Die Sonderabschreibung setzt voraus, dass der Bauantrag nach dem 31.12.2022 und vor dem 1.10.2029 gestellt worden ist. Außerdem muss die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden neun Jahren nicht nur vorübergehend zu Wohnzwecken genutzt werden. Ferner muss die Wohnung in einem Gebäude liegen, das das Qualitätssiegel „Nachhaltiges Gebäude“ für sog. klimafreundliches Bauen trägt. Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten pro Quadratmeter Wohnfläche dürfen nicht höher sein als 5.200 €. Schließlich muss der Kauf einer solchen Wohnung bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung erfolgen.
Hinweis: Wird die Wohnung nicht zehn Jahre lang vermietet oder vorher verkauft oder wird die Baukostenobergrenze durch nachträgliche Baumaßnahmen überschritten, ist die Sonderabschreibung rückgängig zu machen.
Für vermietete neue Wohngebäude kann auch eine degressive Abschreibung in Höhe von 5 % in Anspruch genommen werden. Voraussetzung ist, dass mit der Herstellung des in Deutschland oder in der EU bzw. im EWR (Island, Liechtenstein und Norwegen) befindlichen Gebäudes nach dem 30.9.2023 und vor dem 1.10.2029 begonnen worden ist oder dass das Gebäude nach dem 30.9.2023 und vor dem 1.10.2029 gekauft wird und der Nutzen- und Lastenwechsel bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung erfolgt ist.
2. Verlust aus Zins-Währungs-Swaps im Rahmen der Fremdfinanzierung
Wird der Erwerb der Immobilie durch ein Fremdwährungsdarlehen finanziert und das Kursrisiko dieses Darlehens durch einen sog. Zins-Währungs-Swap abgesichert, kann ein Verlust, der bei der späteren Beendigung des Zins-Währungs-Swaps entsteht, nicht bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung als Werbungskosten abgesetzt werden. Dieser Verlust rührt dem BFH zufolge nämlich aus dem Fremdwährungsrisiko und betrifft damit die nicht steuerbare Vermögenssphäre. Der Verlust aus dem Zins-Währungs-Swap ist also ebenso wenig absetzbar wie die Tilgungsbeträge für das Darlehen.
3. Kein Vorsteuerabzug aus Anschaffung einer neuen Heizung
Ein Vermieter, der Wohnungen umsatzsteuerfrei vermietet, kann die Vorsteuer aus der Anschaffung einer neuen Heizungsanlage nach einer aktuellen Entscheidung des BFH nicht geltend machen, weil sie in direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit den umsatzsteuerfreien Vermietungsumsätzen steht.
Hinweis: Der Vorsteuerabzug wäre jedoch möglich, wenn die Vermietung umsatzsteuerpflichtig an einen anderen Unternehmer erfolgen würde.
4. Gemeinnützigkeit bei Vermietung an Bedürftige
Die Vermietung an bedürftige Mieter soll ab 2025 gemeinnützig ausgestaltet werden, s. o. Abschn. II.7.
5. Vermietung an nahe Angehörige
Bei der Vermietung einer Wohnung an nahe Angehörige sollte darauf geachtet werden, dass der Mietvertrag fremdüblich ist und auch tatsächlich durchgeführt wird. Insbesondere sollten die Miete bei Fälligkeit nachweisbar gezahlt werden und die jährliche Betriebskostenabrechnung rechtzeitig erstellt und die entsprechende Nachzahlung bzw. Erstattung pünktlich beglichen werden.
Außerdem sollte die ortsübliche Miete nicht zu sehr unterschritten werden; anderenfalls werden die mit der Vermietung zusammenhängenden Werbungskosten nicht oder nur zum Teil anerkannt. Dies gilt nicht nur bei einer Vermietung an nahe Angehörige, sondern auch an fremde Dritte.
Die vereinbarte Miete sollte nach dem Gesetz mindestens 66 % der ortsüblichen Miete betragen. Liegt die Miete darunter und beträgt sie mindestens 50 % der ortsüblichen Miete, wird die Einkünfteerzielungsabsicht anhand einer Prognose für einen Zeitraum von 30 Jahren geprüft. Fällt diese Prognose negativ aus, wird ein Werbungskostenabzug nur für den entgeltlichen Teil der Vermietung anerkannt.
Hinweis: Daher sollte auch nicht unbedacht auf Mieterhöhungen verzichtet werden, weil dies zu einer zu niedrigen Miete führen kann.
Vorsicht ist geboten, wenn eine Wohnung oder ein Haus mit einer Wohnfläche von mehr als 250 qm dauerhaft vermietet wird. Hier ist nach der Rechtsprechung des BFH die Prüfung der Einkünfteerzielungsabsicht erforderlich, falls ein Verlust steuerlich geltend gemacht wird. Bei derart großen Wohnobjekten gibt es nämlich keine ortsübliche Marktmiete, die als Vergleichsmaßstab herangezogen werden kann.
V. Kapitalanleger
1. Verkauf eines Grundstücks nach vorherigem Erwerb der Erbanteile
Zwar kann der Verkauf von Grundstücken des Privatvermögens innerhalb von zehn Jahren nach dem Kauf zu einem steuerpflichtigen Spekulationsgewinn führen. Ein Spekulationsgewinn entsteht nach der BFH-Rechtsprechung allerdings nicht, wenn der Grundstücksverkäufer das Grundstück vorher nicht gekauft hat, sondern nur die Erbanteile einer Erbengemeinschaft, der das Grundstück gehört hat, erworben hat. Das verkaufte Wirtschaftsgut (Grundstück) und das angeschaffte Wirtschaftsgut (Erbanteil) sind dann nicht gleichartig, funktionsgleich und gleichwertig, wie dies für einen steuerpflichtigen Spekulationsgewinn erforderlich wäre.
Hinweis: Der BFH widerspricht der Auffassung der Finanzverwaltung und erleichtert damit die Verwertung von Grundstücken, die zu einer Erbengemeinschaft gehören, wenn lediglich ein Erbanteil – und nicht das Grundstück selbst – erworben wird.
2. Spekulationsgewinn bei Selbstnutzung
Zwar nimmt der Gesetzgeber selbst genutzte Immobilien von der Steuerpflicht für Spekulationsgewinne grundsätzlich aus. Die unentgeltliche Überlassung der Immobilie an einen Elternteil stellt dem BFH zufolge aber keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken dar. Der Spekulationsgewinn ist daher steuerpflichtig.
Hinweis: Anders ist dies, wenn die Immobilie unentgeltlich dem eigenen Kind überlassen wird, wenn dieses einkommensteuerlich zu berücksichtigen ist, das Kind also z. B. noch minderjährig ist.
Die Steuerpflicht eines Spekulationsgewinns ist nach Auffassung des BFH auch dann zu bejahen, wenn der Steuerpflichtige innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist ein selbstgenutztes Grundstück in zwei Flurstücke teilt und das unbebaute Flurstück mit Gewinn verkauft. Die Steuerpflicht entfällt nicht deshalb, weil das Grundstück bis zu seiner Teilung selbstgenutzt worden ist.
Hinweis: Der Fall wäre möglicherweise anders entschieden worden, wenn nach der Teilung des Grundstücks beide Flurstücke wie bisher weitergenutzt und dann innerhalb der Spekulationsfrist zusammen veräußert worden wären. Der BFH hat dies jedoch offengelassen.
3. Entnahmen und Einlagen
Zwar führen weder Entnahmen aus dem Betriebsvermögen noch Einlagen in das Betriebsvermögen zu einem Spekulationsgewinn. Dennoch können sie sich auf Spekulationsgewinne auswirken. Denn eine Entnahme gilt als Anschaffung, so dass die Spekulationsfrist, die bei Grundstücken zehn Jahre und bei allen anderen Wirtschaftsgütern ein Jahr beträgt, neu zu laufen beginnt.
Bei der Einlage eines Grundstücks in das Betriebsvermögen läuft die Spekulationsfrist weiter, so dass bei einem Verkauf des nunmehr im Betriebsvermögen befindlichen Grundstücks innerhalb von zehn Jahren nach dem Kauf die Wertsteigerung zwischen Kauf und Einlage als steuerpflichtiger Spekulationsgewinn erfasst wird.
4. Freigrenze für Spekulationsgewinne
Seit 2024 gilt eine Freigrenze für Spekulationsgewinne von 1.000 €, die zuvor lediglich 600 € betragen hatte. Es handelt sich hierbei nicht um einen Freibetrag: Wird die Freigrenze auch nur geringfügig überschritten, ist der gesamte Spekulationsgewinn steuerpflichtig.
Hinweis: Zusammenveranlagten Ehegatten steht die Freigrenze einzeln zu, sofern jeder von ihnen Veräußerungsgewinne erzielt hat. Jedoch kann die ggf. von einem Ehegatten nicht ausgeschöpfte Freigrenze nicht beim anderen Ehegatten berücksichtigt werden.
5. Widerruf eines Immobilienkreditvertrags
Der Widerruf eines privaten Immobilienkredits nach mehreren Jahren führt nicht zu steuerpflichtigen Einkünften, auch wenn es aufgrund des Widerrufs zu einer wechselseitigen Rückgewähr der gezahlten Leistungen und damit zur Zahlung eines sog. Nutzungsersatzes an den Kreditnehmer kommt. Dem BFH zufolge findet die Rückabwicklung außerhalb der steuerbaren Erwerbssphäre statt.
Hinweis: Nach aktueller Rechtslage führt der Widerruf eines Immobilienkredits nicht mehr zur Zahlung eines Nutzungsersatzes an den Kreditnehmer. Die BFH-Rechtsprechung betrifft also Fälle, in denen nach früherer Rechtslage der Widerruf erklärt worden ist und der Nutzungsersatz jetzt gezahlt wird.
6. Verlustverrechnungsbeschränkung bei Termingeschäften
Verluste aus Termingeschäften können seit 2021 nur mit Gewinnen aus Termingeschäften verrechnet werden, und dies auch nur bis zur Höhe von 20.000 € pro Jahr. Eine Verrechnung mit anderen positiven Einkünften oder über einen Betrag von 20.000 € hinaus ist nicht möglich.
Diese Regelung hält der BFH für verfassungswidrig, weil sie seiner Auffassung nach gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verstößt. Der Gesetzgeber hat die Bedenken des BFH aufgegriffen und will die Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte streichen. Ebenfalls gestrichen werden soll die betragsmäßige Beschränkung der Verrechenbarkeit von Verlusten aus Forderungsausfällen (zurzeit bis zu einer Höhe von 20.000 € verrechenbar). Die neuen Regelungen sollen in allen noch offenen Fälle gelten. Sollte sich hieran etwas ändern, werden wir Sie informieren.
Hinweis: Der BFH hält auch die Verlustverrechnungsbeschränkung für Verluste aus Aktienverkäufen für verfassungswidrig und hat im Jahr 2020 das BVerfG angerufen, das bislang noch nicht entschieden hat.
VI. Alle Steuerzahler
1. Grunderwerbsteuer
Die Grunderwerbsteuerbefreiungen bei Grundstücksübertragungen zwischen Personengesellschaften und ihren Gesellschaftern gelten noch bis zum 31.12.2026. Zum Jahreswechsel 2024/2025 besteht daher kein akuter Handlungsbedarf, falls diese Befreiungen im Rahmen einer Umstrukturierung genutzt werden sollen. Allerdings sollte man derartige Umstrukturierungen mit Grundstücksübertragungen nicht erst Ende des Jahres 2025 durchführen, wenn die Termine bei Notaren knapp werden, sondern frühzeitig im Jahr 2025 angehen.
Ausdrücklich geregelt werden soll künftig die Zugehörigkeit eines Grundstücks zum Vermögen einer Personengesellschaft. Auf diese Weise soll Rechtssicherheit geschaffen werden, wenn z. B. Anteile an einer Personengesellschaft, die Grundstücke hält, verkauft werden. Eine Doppelzugehörigkeit eines Grundstücks zum Vermögen zweier Personengesellschaft soll ebenso vermieden werden wie Missbrauchsgestaltungen, bei denen eine Personengesellschaft vorübergehend grundbesitzlos gestellt werden soll, um die Anteile an ihr ohne Belastung mit Grunderwerbsteuer zu veräußern. Sollten sich an der geplanten Regelung Änderungen ergeben, werden wir hierüber berichten.
2. Aussetzungszinsen und Säumniszuschläge
Offen ist derzeit, ob der Zinssatz von 0,5 % monatlich bzw. 6 % jährlich für Zinsen wegen der Aussetzung der Vollziehung eines Steuerbescheids verfassungskonform ist. Der BFH hält den Zinssatz für Zeiträume ab dem 1.1.2019 für unverhältnismäßig und gleichheitswidrig, da Nachzahlungszinsen für Zeiträume ab dem 1.1.2019 nur 0,15 % monatlich (1,8 % jährlich) betragen. Der BFH hat deshalb das BVerfG angerufen, das nun über die Verfassungsmäßigkeit entscheiden muss.
Aussetzungszinsen werden festgesetzt, wenn der Steuerpflichtige einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des Steuerbescheids mit Erfolg gestellt hat, dann aber das spätere Einspruchs- bzw. Klageverfahren gegen den Steuerbescheid verliert.
Hinweis: Bis zu einer Entscheidung des BVerfG sollte daher gegen eine Zinsfestsetzung aufgrund einer Aussetzung der Vollziehung Einspruch eingelegt werden; das Einspruchsverfahren ruht dann wegen des anhängigen Verfahrens beim BVerfG automatisch.
Ebenfalls verfassungsrechtlich umstritten ist die Höhe der Säumniszuschläge, die bei einer verspäteten Zahlung von Steuern entstehen und die zurzeit 1 % pro Monat bzw. 12 % pro Jahr betragen. Allerdings ist hierzu noch kein Verfahren vor dem BVerfG anhängig. Vielmehr existieren lediglich unterschiedliche Entscheidungen der einzelnen BFH-Senate, wobei die Mehrheit der BFH-Senate die Höhe der Säumniszuschläge für verfassungskonform hält.
Hinweis: Um sich gegen Säumniszuschläge zu wehren, sollte ein Abrechnungsbescheid beantragt und gegen diesen Einspruch eingelegt werden.
3. Außergewöhnliche Belastungen
Außergewöhnliche Belastungen können steuerlich abgesetzt werden. Zu den außergewöhnlichen Belastungen gehören Aufwendungen, die dem Steuerpflichtigen zwangsläufig entstehen, weil er sich ihnen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann und die notwendig und angemessen sind, z. B. Krankheitskosten.
Zu den absetzbaren Krankheitskosten zählen dem BFH zufolge Aufwendungen einer Frau für eine Präimplantationsdiagnostik mit anschließender künstlicher Befruchtung, wenn ihr Partner unter einer Chromosomenmutation leidet. Dies gilt auch dann, wenn das Paar nicht verheiratet ist.
Adoptionskosten sind hingegen nicht als außergewöhnliche Belastungen absetzbar, weil es sich nicht um Krankheitskosten handelt, sondern sie auf einer freiwilligen Entscheidung der Adoptionseltern beruhen. Nach Auffassung des FG Münster gilt dies auch dann, wenn bisherige Kinderwunschbehandlungen erfolglos geblieben sind.
Weiterhin zu beachten ist eine geplante Änderung in Bezug auf den Abzug von Unterhaltszahlungen, die an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen geleistet werden. Zurzeit können solche Zahlungen auch in bar übergeben werden, ohne dass dies der Anerkennung der Kosten entgegenstünde. Künftig soll ein Abzug der Unterhaltsaufwendungen bei Geldzahlungen nur noch im Fall einer Banküberweisung möglich sein. Sollte sich hieran etwas ändern, werden wir Sie informieren.
4. Grundsteuerreform
Verbessert hat sich der Rechtsschutz für Grundstückseigentümer, die sich beim Bundesmodell im Rahmen der Grundsteuerreform gegen überhöhte Grundsteuerwerte wehren wollen. Der BFH gewährt die Aussetzung der Vollziehung des Grundsteuerwertbescheids, wenn der Steuerpflichtige Einspruch einlegt, Aussetzung der Vollziehung beantragt und schlüssig darlegt, dass der festgestellte Grundsteuerwert laut Bescheid den Verkehrswert des Grundstücks um mindestens 40 % übersteigt.
Die Finanzverwaltung akzeptiert die Rechtsprechung des BFH. Erfolgt der schlüssige Vortrag, dass der festgestellte Grundsteuerwert laut Bescheid den Verkehrswert des Grundstücks um mindestens 40 % übersteigt, soll die Aussetzung der Vollziehung gewährt und der Steuerpflichtige innerhalb der Frist zum Nachweis des niedrigen Verkehrswertes, z. B. durch Vorlage des Sachverständigengutachtens, aufgefordert werden. Alternativ kann der erheblich niedrigere Verkehrswert auch anhand eines Kaufpreises, der ein Jahr vor oder nach dem Feststellungszeitpunkt gezahlt worden ist, nachgewiesen werden. Anschließend kann dann über die Gewährung der Aussetzung der Vollziehung bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens entschieden werden.
Hinweis: Dem folgend soll die Möglichkeit zum Nachweis eines geringeren Grundstückswerts gesetzlich für alle Grundsteuermodelle geregelt werden. Zur Frage, ob die Grundsteuerreform selbst verfassungsgemäß ist, sind bundesweit mehrere Verfahren vor unterschiedlichen Finanzgerichten anhängig.
5. Verbesserung des steuerlichen Verlustausgleichs
Die sog. Mindestbesteuerung wurde in den Veranlagungszeiträumen 2024 bis 2027 von 40 % auf 30 % gesenkt. Wird also ein Verlust von mehr als 1 Mio. € in ein Folgejahr vorgetragen und dort mit positiven Einkünften von mehr als 1 Mio. € verrechnet, müssen nur 30 % des Betrags, der 1 Mio. € übersteigt, besteuert werden.
6. Erbschaftsteuer
Der sog. Erbfallkostenpauschbetrag, der im Erbfall ohne weiteren Nachweis z. B. zur Bestreitung der Beerdigungskosten oder zur Regelung des Nachlasses vom Erbe abgezogen werden kann, soll inflationsbedingt von 10.300 € auf 15.000 € angehoben werden. Die Regelung soll auf Erwerbe angewendet werden, für die die Steuer ab dem Monat, der der Verkündung des geplanten Gesetzes folgt, entsteht. Über den genauen Anwendungszeitpunt werden wir berichten.
Weitere Neuerungen sind in Fällen der beschränkten Erbschaftsteuerpflicht geplant. Hier sind bislang nur solche Nachlassverbindlichkeiten abzugsfähig, die mit einzelnen Vermögensgegenständen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, die der deutschen Besteuerung unterliegen. Der Europäische Gerichtshof hat diese Regelung beanstandet. Der Gesetzgeber plant daher, die anteilige Abziehbarkeit von Nachlassverbindlichkeiten bei beschränkter Steuerpflicht auf andere Nachlassverbindlichkeiten auszuweiten, z. B. auf Pflichtteilsverbindlichkeiten. Der abziehbare Anteil soll sich nach dem Anteil richten, mit dem der Erbfall der deutschen Erbschaftsteuer unterliegt.
Ferner soll die Erbschaftsteuerbefreiung von 10 %, die bei vermieteten Wohnimmobilien gewährt wird, die in der EU oder im EWR liegen, auch für zu Wohnzwecken dienende Immobilien gewährt werden, die sich in einem Drittstaat befinden. Erforderlich ist jedoch, dass mit dem Drittstaat ein umfassender Informationsaustausch besteht, damit die Voraussetzungen der Steuerbefreiung überprüft werden können. Diejenigen Drittstaaten, die diese Voraussetzungen erfüllen, sollen von der Finanzverwaltung bekanntgegeben werden. Auch dies ist eine Reaktion des Gesetzgebers auf ein Urteil des EuGH.
Hinweis: Die Finanzverwaltung hat bereits das EuGH-Urteil akzeptiert und die jetzt geplante gesetzliche Regelung in einer Verwaltungsanweisung vorweggenommen.
Erweitert werden soll ferner die Stundungsmöglichkeit bei der Vererbung oder Schenkung von Grundbesitz. Der Erbe bzw. Beschenkte kann eine Stundung der Erbschaftsteuer von bis zu zehn Jahren beantragen, wenn er die Steuer nur durch Veräußerung des geerbten oder geschenkten Grundbesitzes aufbringen könnte. Diese Stundungsmöglichkeit gilt bislang nur für Mietimmobilien in Deutschland, der EU und im EWR sowie für Immobilien, die der Erbe bzw. Beschenkte selbst nutzen will. In dem zuletzt genannten Fall wird die Stundung längstens auf die Dauer der Selbstnutzung beschränkt.
Der Gesetzgeber will diese Stundungsregelung nun zum einen auf sämtliche Fälle ausweiten, in denen Grundbesitz zu Wohnzwecken genutzt wird. Die Stundung soll also auch dann gewährt werden können, wenn das Grundstück nach dem Erbfall oder der Schenkung zu Wohnzwecken vermietet wird. Beendet wird die Stundung aber mit der Beendigung der Nutzung der Immobilie zu Wohnzwecken oder mit der Veräußerung. Wie bisher ist für die Stundung erforderlich, dass die Steuer nur durch Veräußerung des geerbten oder geschenkten Grundbesitzes gezahlt werden könnte. Zum anderen soll die Stundung auch dann gewährt werden können, wenn sich der Grundbesitz in einem Drittstaat außerhalb der EU bzw. des EWR befindet und mit dem Drittstaat ein umfassender Informationsaustausch vereinbart ist.
Sollten sich an den geplanten Regelungen Änderungen ergeben, werden wir Sie informieren.
7. Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen
Im Rahmen der Steuererklärung 2024 sollte geprüft werden, ob Aufwendungen für Handwerker, haushaltsnahe Dienstleistungen oder für Haushaltshilfen im Jahr 2024 angefallen sind. In diesem Zusammenhang können 20 % der Aufwendungen geltend gemacht werden, maximal aber 510 € bzw. 4.000 € bei den Beschäftigungsverhältnissen sowie Dienstleistungen und maximal 1.200 € bei den Handwerkerleistungen. Abzugsfähig sind die Lohnkosten, nicht aber die Materialkosten z. B. bei einer Reparatur. Die Steuerermäßigung mindert nicht das zu versteuernde Einkommen, sondern wird direkt von der Steuer abgezogen.
Begünstigte Aufwendungen fallen insbesondere bei der Wohnungsverwaltung an, z. B. Kosten für den Hausmeister, Gärtner, Winterdienst oder die Hausreinigung. Diese Aufwendungen können in der Betriebskostenabrechnung oder Wohngeldabrechnung eingesehen werden.
8. Anhebung von Freibeträgen und des Kindergelds
Der Gesetzgeber plant eine rückwirkende Anhebung des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer für das Jahr 2024 um 180 € auf 11.784 €. Auch für das Jahr 2025 und 2026 ist eine Anhebung geplant – die Höhe steht derzeit noch nicht fest.
Außerdem soll der steuerliche Kinderfreibetrag rückwirkend für das Jahr 2024 um 114 € auf 3.306 € steigen (6.612 € bei Zusammenveranlagung). Ab 2025 soll der Kinderfreibetrag dann nochmals steigen, auch hier ist die genaue Höhe zurzeit noch unklar. Gleiches gilt für die Anhebung des Kindergeldes. Über die genauen Beträge werden wir berichten.
Hinweis: Die für das Jahr 2024 vorgesehenen Änderungen sollen mit der Lohn-, Gehalts- bzw. Bezügeabrechnung für Dezember 2024 umgesetzt werden. Die entsprechenden Programmablaufpläne wurden inzwischen vom BMF veröffentlicht.
9. Abzug von Kinderbetreuungskosten
Ab 2025 soll der Sonderausgabenabzug von Kinderbetreuungskosten verbessert werden. Während bisher zwei Drittel der Aufwendungen für Kinderbetreuung, höchstens 4.000 € je Kind, als Sonderausgaben berücksichtigt werden können, soll die Begrenzung von zwei Drittel der Aufwendungen auf 80 % der Aufwendungen erhöht werden. Der Höchstbetrag soll auf 4.800 € steigen.
10. Bonuszahlungen von Krankenkassen
Der Gesetzgeber will Bonusleistungen von Krankenkassen, die diese für gesundheitsbewusstes Verhalten zahlen, bis zur Höhe von 150 € pro Person und Jahr ab 1.1.2025 nicht als Beitragserstattung behandeln. Damit soll der Sonderausgabenabzug für Krankenversicherungsbeiträge durch derartige Bonusleistungen nicht gemindert werden.
Übersteigt der Bonus 150 €, soll es sich zwar grundsätzlich um eine Beitragsrückerstattung handeln. Jedoch kann der Steuerpflichtige nachweisen, dass es sich auch insoweit um Leistungen der Krankenkasse handelt, die für gesundheitliche Vorsorge- und Schutzmaßnahmen geleistet werden, die nicht vom Basiskrankenversicherungsschutz umfasst sind, und für die der Steuerpflichtige daher eigene Aufwendungen getragen hat.
11. Abgabefrist für Steuererklärungen
Wer seine Steuererklärung durch einen Berater erstellen lässt, muss die Steuererklärung für 2024 bis zum 30.4.2026 beim Finanzamt abgeben.
Für Land- und Forstwirte, die ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben, endet die Abgabefrist am 30.9.2026.
Hinweis: Die Steuererklärung für 2023 ist bis zum 2.6.2025 dem Finanzamt zu übermitteln. Für Land- und Forstwirte mit einem abweichenden Wirtschaftsjahr endet die Abgabefrist für 2023 am 31.10.2025 bzw. – in den Bundesländern, in denen der 31.10.2025 ein gesetzlicher Feiertag ist – am 3.11.2025.