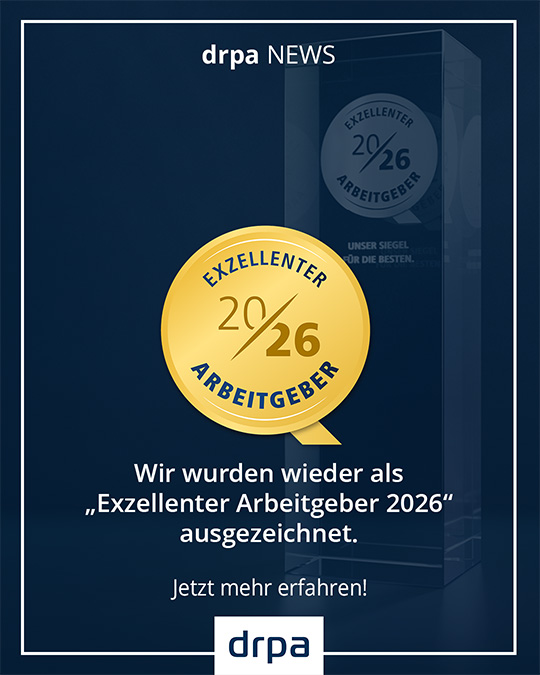Sonderausgabe zum Jahresende 2025
I. Unternehmer
1. Degressive Abschreibung
Der Gesetzgeber hat eine befristete degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nach dem 30.6.2025 und vor dem 1.1.2028 angeschafft oder hergestellt werden, eingeführt. Die degressive Abschreibung beträgt maximal das Dreifache der regulären linearen Abschreibung, die sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer richtet. Der Abschreibungssatz für die degressive Abschreibung darf 30 % nicht übersteigen.
Die degressive Abschreibung richtet sich im ersten Jahr nach den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und in den Folgejahren nach dem Buchwert des letzten Wirtschaftsjahres, nimmt also mit jedem Jahr ab.
Beispiel: A erwirbt im Januar 2026 eine Maschine zum Preis von 100.000 €, deren Nutzungsdauer zehn Jahre beträgt. Die lineare Abschreibung beträgt 10 %, so dass sich die degressive Abschreibung für 2026 auf maximal das Dreifache der linearen Abschreibung (hier: 30 % [= 30.000 €]) beläuft. Der Höchstsatz von 30 % wird nicht überschritten. Der Buchwert zum 31.12.2026 beträgt somit 70.000 €. Für 2027 ergibt sich damit eine degressive Abschreibung in Höhe von höchstens 21.000 € (30 % von 70.000 €, Buchwert zum 31.12.2027 somit 49.000 €). Für 2028 beträgt die degressive Abschreibung dann maximal 14.700 € (30 % von 49.000 €).
Im Jahr der Anschaffung darf die degressive Abschreibung nur zeitanteilig in Anspruch genommen werden, beispielsweise bei einer Anschaffung am 1.10. also nur zu 3/12 des Jahresbetrags. Im Jahr 2025 ist daher lediglich eine degressive Abschreibung von maximal 15 % möglich, da sie nur für Wirtschaftsgüter gilt, die nach dem 30.6.2025 angeschafft werden (s. o.).
Hinweis: In einem Folgejahr kann der Unternehmer zur linearen Abschreibung wechseln, wenn diese höher ausfällt als die degressive Abschreibung.
Eine degressive Abschreibung gab es in den letzten Jahren bereits zweimal, und zwar in unterschiedlicher Ausprägung: Zunächst war eine degressive Abschreibung für Wirtschaftsgüter möglich, die in den Jahren 2020, 2021 oder 2022 angeschafft oder hergestellt worden sind; der Abschreibungssatz betrug maximal das Zweieinhalbfache der linearen Abschreibung, höchstens 25 %. Anschließend gab es eine degressive Abschreibung für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.3.2024 und vor dem 1.1.2025 angeschafft oder hergestellt worden sind; der Abschreibungssatz betrug maximal das Doppelte der linearen Abschreibung, höchstens jedoch 20 %.
2. Arithmetisch-degressive Abschreibung für Elektrofahrzeuge
Eine besondere Form der degressiven Abschreibung ist für betrieblich genutzte reine Elektrofahrzeuge eingeführt worden, die nach dem 30.6.2025 und vor dem 1.1.2028 angeschafft werden. Die sog. arithmetisch-degressive Abschreibung ermöglicht eine Abschreibung in Höhe von 75 % im Jahr der Anschaffung, von 10 % im 2. Jahr, von jeweils 5 % im 3. und im 4. Jahr, von 3 % im 5. Jahr und von 2 % im 6. Jahr. Damit kann das Elektrofahrzeug in sechs Jahren vollständig abgeschrieben werden. Es kann sich dabei auch um gebrauchte Fahrzeuge handeln, nicht aber um geleaste Elektrofahrzeuge, die steuerlich dem Leasinggeber zuzurechnen sind.
Hinweis: Im Jahr der Anschaffung ist die arithmetisch-degressive Abschreibung in Höhe von 75 % in vollem Umfang möglich und wird nicht nur zeitanteilig gewährt. Es dürfen jedoch nicht zugleich Sonderabschreibungen für das Fahrzeug in Anspruch genommen werden.
Zur Anhebung der Preisgrenze für Elektrofahrzeuge von 70.000 € auf 100.000 € bei der Anwendung der sog. 0,25 %-Methode für Entnahmen wegen privater Nutzung eines betrieblichen Elektrofahrzeugs. s. Abschn. 6.
3. Rücklage für bestimmte Veräußerungsgewinne
Gewinne aus der Veräußerung bestimmter Wirtschaftsgüter, wie z. B. Grundstücke, können durch eine Rücklage neutralisiert werden, die grundsätzlich innerhalb von vier Jahren auf ein neues Wirtschaftsgut (z. B. ein neues Grundstück) übertragen werden muss (sog. Reinvestition). Daher sollte geprüft werden, ob entsprechende Gewinne im Jahr 2025 entstanden sind, die durch eine Rücklage neutralisiert werden könnten.
Hinweis: Ist eine Rücklage gebildet worden, kann sie auch auf einen anderen Betrieb des Unternehmers übertragen werden, wenn in dem anderen Betrieb die Reinvestition erfolgt. Auch eine Übertragung der Rücklage auf eine unternehmerisch tätige Personengesellschaft ist möglich, soweit der Steuerpflichtige an der Personengesellschaft beteiligt ist. Handelt es sich bei der Personengesellschaft um eine KG bzw. GmbH & Co. KG, bei der Verlustanteile nicht uneingeschränkt ausgleichsfähig sind, ist zu beachten, dass sich aufgrund der Übertragung der Rücklage auf die Personengesellschaft das Kapitalkonto des Steuerpflichtigen und damit auch sein Verlustausgleichsvolumen mindert, wie eine aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt.
4. Kryptowährung
Die Finanzverwaltung hat ein umfangreiches Schreiben zur steuerlichen Behandlung von Kryptowährung veröffentlicht und dem Steuerpflichtigen umfassende Aufzeichnungs- und Mitwirkungspflichten auferlegt. Verwendet der Steuerpflichtige z. B. eine spezielle Software für die Aufzeichnung von Kryptowerten, muss er für die Software eine sog. Verfahrensdokumentation erstellen. Allerdings ist höchstrichterlich noch nicht geklärt, ob diese Aufzeichnungs- und Mitwirkungspflichten mit dem Gesetz vereinbar sind.
Absolut praxisrelevant ist die Frage, ob Geschäfte mit Kryptowährung auch in der Steuererklärung angegeben werden. Die Bundesregierung geht von einer hohen Dunkelziffer nicht gemeldeter Fälle aus und plant eine Gesetzesänderung: Danach sollen Betreiber von Krypto-Handelsplattformen für Zeiträume ab 2026 verpflichtet werden, Transaktionen in Kryptowährung dem Finanzamt zu melden – auch über Ländergrenzen hinweg. Ziel ist es, durch mehr Transparenz Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung zu verhindern. Die Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes ist wahrscheinlich, sodass sich Krypto-Händler und Krypto-Anleger hierauf einstellen sollten.
Hinweis: Transaktionen mit Kryptowährungen können zu betrieblichen Einkünften führen, wenn sie im Rahmen eines Gewerbebetriebs erfolgen – etwa bei einem gewerblichen Handel oder wenn die Kryptowährungen dem Betriebsvermögen zugeordnet sind (z. B. als Finanzanlage). Erfolgen die Transaktionen dagegen im Privatvermögen, können sie zu sonstigen Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften führen. Innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist ist ein erzielter Veräußerungsgewinn steuerpflichtig.
5. Übernahme einer Pensionsverpflichtung
Beim Wechsel des Arbeitnehmers zu einem neuen Arbeitgeber wird die Übernahme der bestehenden Pensionsverpflichtungen durch den neuen Arbeitgeber durch eine Entscheidung des BFH vereinfacht. Kommt es aufgrund der Übernahme der Pensionsverpflichtung zu einem Gewinn beim neuen Arbeitgeber, weil er vom bisherigen Arbeitgeber Vermögenswerte übernimmt, deren bilanzieller Wert höher ist als der bilanzielle Wert der Pensionsverpflichtung, kann der neue Arbeitgeber den Gewinn durch Bildung einer Rücklage auf insgesamt 15 Jahre verteilen.
Zu den Wertdifferenzen zwischen der Pensionsverpflichtung und den übernommenen Wirtschaftsgütern kommt es bilanziell dadurch, dass Pensionsverpflichtungen kraft Gesetzes niedriger bewertet werden, als es ihrem wirtschaftlichen Wert entspricht.
Beispiel: Arbeitnehmer A wechselt von seinem bisherigen Arbeitgeber B zum neuen Arbeitgeber C. C übernimmt die Pensionsverpflichtung des B, da B dem A eine Pensionszusage erteilt hat. Die Pensionsverpflichtung ist in der Steuerbilanz des B aufgrund der steuerlichen Passivierungsbeschränkungen nur mit einem Betrag von 400.000 € passiviert; tatsächlich beträgt die wirtschaftliche Belastung aber 550.000 €. B überträgt dem C daher Wertpapiere in Höhe von 550.000 €. Bei C kommt es hierdurch zu einem Buchgewinn von 150.000 €, den C auf insgesamt 15 Jahre verteilen kann.
Hinweis: Der bisherige Arbeitgeber kann den bei ihm entstehenden bilanziellen Aufwand sofort abziehen und muss ihn nicht über 15 Jahre verteilen.
6. Private Nutzung betrieblicher Pkw
Nutzt ein Unternehmer ein betriebliches Fahrzeug auch privat, muss er hierfür eine Entnahme versteuern. Bei einer betrieblichen Nutzung von mehr als 50 % kann er die Entnahme nach der sog. 1 %-Methode bewerten, d. h. mit monatlich 1 % des Bruttolistenpreises des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Erstzulassung zzgl. der Kosten der Sonderausstattung.
Hinweis: Bei Hybridfahrzeugen mindert sich der Entnahmewert auf 0,5 % des Bruttolistenpreises monatlich, sofern das Fahrzeug gewisse Anforderungen hinsichtlich seiner Reichweite oder des CO2-Ausstoßes erfüllt. Bei reinen Elektrofahrzeugen mindert sich der Entnahmewert auf bis zu 0,25 % des Bruttolistenpreises, sofern der Bruttolistenpreis einen gewissen Höchstbetrag nicht übersteigt. Dieser Betrag wurde für Elektrofahrzeuge, die nach dem 30.6.2025 angeschafft wurden bzw. werden, von 70.000 € auf 100.000 € angehoben.
Alternativ kann der Unternehmer die Entnahme mithilfe der sog. Fahrtenbuchmethode ermitteln, indem er die Privatfahrten anhand eines ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuchs nachweist. Die Entnahme wird mit den auf die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen bewertet, zu denen u. a. die Abschreibungen zählen. Bei Hybridfahrzeugen dürfen für die Privatnutzung unter gewissen Voraussetzungen 50 % der Abschreibungen angesetzt werden. Bei Elektrofahrzeugen sind es 25 %, sofern der Bruttolistenpreis des Elektrofahrzeugs den Betrag von 100.000 € (bei Anschaffung nach dem 30.6.2025) bzw. 70.000 € (bei Anschaffung bis einschließlich 30.6.2025) nicht übersteigt.
Auch wenn eine private Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs durch den Steuerpflichtigen nicht feststeht, ist eine Entnahme grundsätzlich zu versteuern. Denn nach der aktuellen Rechtsprechung des BFH spricht ein sog. Anscheinsbeweis für die private Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs.
Ein derartiger Anscheinsbeweis kann jedoch erschüttert werden, indem der Steuerpflichtige einen anderen Geschehensablauf plausibel darlegt. Dies kann in der Weise geschehen, dass er ein Fahrtenbuch vorlegt, aus dem sich eine ausschließliche betriebliche Nutzung des Fahrzeugs ergibt; dem BFH zufolge muss das Fahrtenbuch nicht zwingend ordnungsgemäß sein, sofern es lediglich um die Erschütterung des Anscheinsbeweises geht.
Hinweis: Für die Praxis empfiehlt es sich trotz des BFH-Urteils, ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vorzulegen, um den Anscheinsbeweis möglichst effektiv zu erschüttern. Außerdem kann mit einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch die pauschale 1 %-Methode für die Ermittlung des geldwerten Vorteils ersetzt werden.
Der Anscheinsbeweis, der für eine private Nutzung des betrieblichen Kfz spricht, kann auch dadurch erschüttert werden, dass der Steuerpflichtige nachweist, dass er über vergleichbare Pkw im Privatvermögen verfügt, die ihm uneingeschränkt zur Verfügung stehen.
Zur neuen arithmetisch-degressiven Abschreibung für Elektrofahrzeuge, die nach dem 30.6.2025 angeschafft werden, s. oben Abschn. 2.
7. Unentgeltliche Übertragung eines Betriebs unter Vorbehaltsnießbrauch
Vorsicht ist geboten, wenn der Betriebsinhaber seinen Betrieb unentgeltlich auf ein Kind übertragen, sich aber einen Nießbrauch vorbehalten und den Betrieb erst einmal weiterführen will. Nach der aktuellen Rechtsprechung des BFH kommt es dann zu einer Aufdeckung der stillen Reserven beim bisherigen Betriebsinhaber. Zwar gibt es eine gesetzliche Regelung, die eine unentgeltliche Betriebsübertragung zum Buchwert ermöglicht. Die Anwendung dieser Regelung setzt jedoch voraus, dass der bisherige Betriebsinhaber seine gewerbliche Tätigkeit einstellt, d. h. den Betrieb nicht fortführt.
8. Rangrücktritt
Befindet sich das Unternehmen entweder in einer finanziell angespannten Lage oder ist damit künftig zu rechnen, sollte geprüft werden, ob mit den Gläubigern eine Rangrücktrittsvereinbarung abgeschlossen werden kann. Eine Rangrücktrittsverbindlichkeit muss nämlich nicht in einer Überschuldungsbilanz aufgeführt werden, so dass eine Überschuldungslage und damit eine Insolvenzantragspflicht vermieden werden kann. Bei der Vereinbarung sollte unbedingt eine Tilgung aus freiem bzw. sonstigen Vermögen vereinbart werden, damit eine gewinnerhöhende Ausbuchung der Verbindlichkeit vermieden wird.
Hinweis: Eine frühzeitige Rangrücktrittsvereinbarung vor dem Eintritt der Krise kann für einen Gläubiger, der zugleich Gesellschafter der Schuldner-GmbH ist, steuerlich vorteilhaft sein, falls er später mit seinem Darlehen ausfällt und seine GmbH-Beteiligung verkauft oder aufgibt; denn dann wird der Nennwert der Darlehensforderung im Rahmen der Ermittlung seines Aufgabe- bzw. Veräußerungsverlustes berücksichtigt und nicht nur der gemeine Wert der Darlehensforderung im Zeitpunkt des Eintritts der Krise.
In der Regel erstreckt sich ein Rangrücktritt auch auf die Zinsforderung des Gläubigers. Solange die GmbH aber zahlungsfähig ist und kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wurde, ist bei einem beherrschenden Gesellschafter als Rangrücktrittsgläubiger zu beachten, dass es bei ihm zu einem fiktiven Zinszufluss kommen kann. Dies hat das Sächsische FG vor kurzem entschieden; denn bei Zahlungsfähigkeit der GmbH hat es der beherrschende Gläubiger-Gesellschafter aufgrund seiner Stimmrechtsmehrheit von mehr als 50 % in der Hand, sich die Zinsen von der GmbH auszahlen zu lassen.
9. Aktivierung von Aufwendungen für Photovoltaikanlagen
Handelsbilanziell sollen Photovoltaikanlagen auf einem Gebäude künftig dem Gebäude zuzurechnen sein, wenn eine Einbaupflicht besteht oder wenn ihr Strom (nahezu) ausschließlich in dem betreffenden Gebäude verbraucht wird. Damit würde der Abschreibungssatz, der für Gebäude gilt, auch für entsprechende Photovoltaikanlagen gelten, die installiert werden.
Hinweis: Allerdings steht noch nicht fest, inwieweit sich diese handelsbilanziellen Änderungen auch steuerlich auswirken werden. Die Finanzverwaltung hat zwar einen Entwurf zur Abgrenzung von Erhaltungsaufwendungen und Anschaffungs-/Herstellungskosten bei Gebäuden vorgelegt, äußert sich hierin aber nicht zur neuen handelsbilanziellen Auffassung zu Photovoltaikanlagen. Bislang werden Photovoltaikanlagen steuerlich auf 20 Jahre und damit in Höhe von 5 % ab Inbetriebnahme jährlich abgeschrieben.
Handelsbilanzrechtlich sollen künftig auch Baumaßnahmen, die zu einer Minderung des Energiebedarfs oder -verbrauchs um mindestens 30 % führen, zu aktivieren sein. Dies entspricht bei Wohngebäuden einer Verbesserung der Energieeffizienzklasse um mindestens zwei Stufen. Ob dies auch steuerlich gelten soll, ist ebenfalls noch nicht geklärt.
10. Aktivierung einer Instandhaltungsrücklage beim Kauf einer betrieblichen Eigentumswohnung
Weiterhin offen ist die Frage, ob beim Erwerb einer Eigentumswohnung, die betrieblich genutzt werden soll (z. B. für die Überlassung an Arbeitnehmer), der Kaufpreisanteil, der auf die sog. Instandhaltungsrücklage (Erhaltungsrücklage) entfällt, gesondert zu aktivieren oder anteilig dem Gebäude und dem Grund und Boden zuzurechnen oder aber vollständig abzuschreiben ist. Hierzu ist eine Revision beim BFH anhängig. Zur steuerlichen Behandlung der Einzahlungen in die Instandhaltungsrücklage s. Abschn. IV. 4.
11. Wechsel der Gewinnermittlungsart nach Abgabe der Bilanz
Erstellt ein Unternehmer, der nicht buchführungspflichtig ist, freiwillig eine Bilanz und übermittelt er die Bilanz an das Finanzamt, kann er danach für dieses Wirtschaftsjahr nicht mehr zur Einnahmen-Überschussrechnung wechseln. Dem BFH zufolge ist ein Wechsel auch dann ausgeschlossen, wenn mit dem Wechsel ein steuerliches Mehrergebnis, das sich aufgrund einer Außenprüfung ergibt, kompensiert werden soll, weil die Einnahmen-Überschussrechnung zu einem niedrigeren Gewinn in diesem Jahr führt oder, weil die Feststellungen des Außenprüfers nur bei einer Bilanzierung zu steuerlichen Mehrergebnissen führen.
Hinweis: Über den gesamten Zeitraum der unternehmerischen Tätigkeit betrachtet, gleichen sich das Gesamtergebnis bei der Bilanzierung und der Einnahmen-Überschussrechnung grundsätzlich aus. In einzelnen Jahren können sich jedoch Unterschiede zwischen beiden Gewinnermittlungsarten ergeben, weil z. B. bei der Bilanzierung eine Forderung gewinnerhöhend aktiviert werden muss, während bei der Einnahmen-Überschussrechnung erst die Bezahlung der Forderung durch den Kunden den Gewinn erhöht.
12. Thesaurierungsbesteuerung für Einzelunternehmen und Personengesellschaften
Gute Nachrichten gibt es – allerdings erst ab 2028 – für Einzelunternehmen und Personengesellschaften, die sich für die sog. Thesaurierungsbesteuerung entscheiden. Bei der Thesaurierungsbesteuerung müssen Einzelunternehmen und Personengesellschaften, die Einkünfte aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit oder aus Land- und Forstwirtschaft erzielen, ihren nicht entnommenen (thesaurierten) Gewinn nicht mit ihrem individuellen Steuersatz, sondern lediglich mit 28,25 % versteuern. Dieser Steuersatz wird in drei Stufen gesenkt, und zwar auf 27 % für die Veranlagungszeiträume 2028 und 2029, auf 26 % für die Veranlagungszeiträume 2030 und 2031 sowie auf 25 % für die Veranlagungszeiträume ab 2032.
13. Aufwendungen für einen Zinsswap
Erschwert wird der Abzug von Ausgleichszahlungen für einen Zinsswap als Betriebsausgaben. Der BFH verlangt nämlich, dass die laufenden Zahlungen für den Zinsswap sogleich in der laufenden Buchführung und nicht erst im Jahresabschluss als Betriebsausgaben erfasst werden. Nur bei sofortiger Erfassung in der laufenden Buchführung lässt sich dem BFH zufolge von Anbeginn erkennen, ob der Unternehmer den Zinsswap tatsächlich aus betrieblichen Gründen eingegangen ist. Der Betriebsausgabenabzug scheitert somit, wenn die laufenden Zahlungen zunächst einmal privat bezahlt und erst im Jahresabschluss als Einlage erfasst werden.
Außerdem muss – wie bisher – der Zinsswap mit einem betrieblichen Darlehen hinreichend eng verknüpft sein. Dies setzt u. a. voraus, dass beide Verträge zeitgleich mit zumindest annähernd übereinstimmenden Laufzeiten abgeschlossen werden, inhaltlich aufeinander Bezug nehmen und die gleiche Zweckbestimmung haben.
14. Grundstücksteile von untergeordnetem Wert
Geändert werden sollen die Wertgrenzen für die Zuordnung von eigenbetrieblich genutzten Grundstücksteilen zum Betriebsvermögen. Bislang kann eine Erfassung von Grundstücksteilen (z. B. häusliches Arbeitszimmer, Garage, Lagerraum) im Betriebsvermögen unterbleiben, wenn der Wert des Grundstücksteils nicht mehr als 1/5 des gemeinen Wertes des gesamten Grundstücks und nicht mehr als 20.500 € betrug. Künftig soll die Erfassung eines eigenbetrieblich genutzten Grundstücksteils als Betriebsvermögen unterbleiben können, wenn der Grundstücksteil nicht größer als 30 qm ist oder sein Wert nicht mehr als 40.000 € beträgt. In diesem Fall soll ein Wahlrecht bestehen: Der Unternehmer soll den Grundstücksteil dem Betriebsvermögen oder dem Privatvermögen zuordnen können.
Hinweis: Hervorzuheben ist die geplante Einführung der auf Quadratmeter gestützten Obergrenze (30 qm). Dies würde es ermöglichen, dass ein häusliches Arbeitszimmer des Unternehmers, welches nicht größer als 30 qm ist, nicht dem Betriebsvermögen zugeordnet werden müsste. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung käme es auf den Wert der Arbeitszimmerfläche nicht an; eine jährliche Überprüfung wegen gestiegener Werte könnte unterbleiben. Nur wenn der Gebäudeteil größer als 30 qm ist, wäre zu prüfen, ob dessen Wert über 40.000 € liegt, so dass eine Zuordnung zum Betriebsvermögen unterbleiben kann.
Unklar ist, ob die dargestellten Änderungen noch bis zum Jahresende beschlossen werden. Wir werden Sie diesbezüglich in unserem Update zu dieser Mandanten-Information informieren.
Die mit dem Grundstücksteil im Zusammenhang stehenden Aufwendungen sind nicht abziehbar, wenn eine Zuordnung zum Betriebsvermögen unterbleibt.
Hinweis: Steuerlich abziehbar bleiben aber die betriebsbezogenen Aufwendungen wie z. B. Strom oder Heizkosten, da diese unverändert betrieblich veranlasst sind.
15. Kaufpreisaufteilung bei Erwerb eines bebauten Grundstücks
Eingeführt werden soll eine neue Regelung für die Aufteilung eines Kaufpreises für ein bebautes Grundstück. Dabei geht es um die Aufteilung des Kaufpreises auf das abschreibbare Gebäude und auf den nicht abschreibbaren Grund und Boden. Aus Sicht des Steuerpflichtigen ist ein hoher Gebäudeanteil erstrebenswert. Bislang gab es keine Regelung, nach welchen Grundsätzen der Kaufpreis aufzuteilen ist.
Geplant ist nun eine Berechnungsmethode, die sich an den immobilienrechtlichen Regelungen für die Grundstücksbewertung orientiert. Allerdings soll die bereits vorhandene Arbeitshilfe der Finanzverwaltung, die diese für die Kaufpreisaufteilung verwendet und die meist zu nachteiligen Ergebnissen für den Steuerpflichtigen führt, weil der Anteil für den Grund und Boden zu hoch ausfällt, aufgewertet werden. Nach der Neuregelung soll sie eine widerlegbare qualifizierte Schätzung darstellen. Die Widerlegung soll durch ein Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken erfolgen können.
Hinweis: Damit würde das Kostenrisiko auf den Steuerpflichtigen übergehen, da er die Aufwendungen für das Sachverständigengutachten tragen muss, wenn er mit dem Ergebnis der finanzamtsfreundlichen Arbeitshilfe nicht einverstanden ist. Ob die geplante Neuregelung in diesem Jahr noch beschlossen wird, ist unklar. Wir werden Sie diesbezüglich auf dem Laufenden halten.
16. Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer eines Gebäudes
Der gesetzliche Abschreibungssatz für Gebäude beträgt entweder 3 %, 2,5 % oder 2 %; dies hängt insbesondere von der Nutzungsart und vom Zeitpunkt des Bauantrags bzw. der Fertigstellung des Gebäudes ab. Diesen Abschreibungssätzen liegt eine Nutzungsdauer von (gerundet) 33 Jahren, 40 Jahren oder 50 Jahren zu Grunde. Der Steuerpflichtige hat jedoch die Möglichkeit, eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer nachzuweisen und damit eine höhere Abschreibung in Anspruch zu nehmen (bei 20 Jahren Nutzungsdauer wären dies 5 % jährlich).
Wie der Nachweis zu führen ist, soll nun gesetzlich geregelt werden. Danach soll ein Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken vorzulegen sein, das Aufschluss über die maßgeblichen technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Faktoren gibt, die die Nutzungsdauer im Einzelfall beeinflussen. Die geplante Neuregelung berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung des BFH, die großzügiger als die bisherige Auffassung des BMF ist.
Hinweis: Gesetzlich geregelt werden soll auch, dass der Gutachter das Grundstück vorab persönlich besichtigen muss. Unzulässig wäre also die Erstellung eines Gutachtens durch einen sog. Internet-Gutachter, der sich das Grundstück lediglich online anschaut, oder durch einen Gutachter, der das Grundstück erst nach Erstellung seines Gutachtens in Augenschein nimmt. Darüber, ob die dargestellten Regelungen noch in diesem Jahr verabschiedet werden, werden wir Sie informieren.
17. Nicht abziehbare Betriebsausgaben
Bestimmte Betriebsausgaben sind steuerlich nicht oder nur eingeschränkt abziehbar. So dürfen beispielsweise Bewirtungsaufwendungen aus geschäftlichem Anlass nur zu 70 % als Betriebsausgaben berücksichtigt werden. Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur dann abziehbar, wenn die Anschaffungskosten 50 € je Empfänger und Jahr nicht überschreiten.
Nach einem Urteil des Finanzgerichts (FG) Köln greift das Abzugsverbot bzw. die Abzugsbeschränkung für Bewirtungsaufwendungen, Geschenke oder unangemessene Repräsentationsaufwendungen nicht, wenn ein Versicherungsunternehmen besonders erfolgreichen Versicherungsvertretern zu Beginn des Jahres Städtereisen einschließlich Schiffsfahrt und Einkaufsgutscheinen verspricht und dieses Versprechen dann einlöst. Denn die Aufwendungen des Versicherungsunternehmens stellt eine Gegenleistung für die erfolgreiche Versicherungsvermittlung des jeweiligen Versicherungsvertreters dar, da das Versicherungsunternehmen eine entsprechende Reise beim Erreichen bestimmter Vermittlungsziele ausgelobt hatte.
Dem FG Münster zufolge fallen die Kosten einer GmbH für die Anschaffung eines Kleinflugzeugs nicht unter das Abzugsverbot für unangemessene Aufwendungen, wenn ein Bezug zur privaten Lebensführung auszuschließen ist. Ein solcher Bezug besteht nicht, wenn das Kleinflugzeug ausschließlich betrieblich genutzt wird, also nicht für privat veranlasste Flüge des Gesellschafter-Geschäftsführers eingesetzt wird, und wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer keine Pilotenlizenz besitzt, so dass er das Flugzeug nicht selbst fliegen kann. Die Aufwendungen für ein Kleinflugzeug sind dann uneingeschränkt abziehbar. Das gilt erst recht, wenn das Kleinflugzeug wegen der schlechten Verkehrsanbindung der GmbH benötigt wird, um zu Geschäftsfreunden und Kunden zu gelangen.
Hinweis: Das Abzugsverbot für unangemessene Aufwendungen setzt nach dem Gesetz voraus, dass ein Bezug zur Lebensführung des Steuerpflichtigen oder einer anderen Person (z. B. Angehörigen) besteht.
18. Nachlaufende Betriebsausgaben bei steuerfreier Photovoltaikanlage
Gewinne aus dem Betrieb kleiner Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von maximal 30 kW (peak) sind seit dem 1.1.2022 grundsätzlich steuerfrei. Höchstrichterlich ist jedoch noch nicht geklärt, ob Betriebsausgaben, die seit dem 1.1.2022 angefallen sind, aber den zuvor steuerpflichtigen Zeitraum des Betriebs der Photovoltaikanlagen bis einschließlich 31.12.2021 betreffen, noch als Betriebsausgaben geltend gemacht werden können. Die Rechtsprechung der Finanzgerichte ist uneinheitlich, so dass der Ausgang der beim BFH anhängigen Revisionsverfahren abgewartet werden muss.
Beispiel: A muss im Jahr 2025 Umsatzsteuer für 2021 nachzahlen, weil das Finanzamt einen Umsatzsteuerbescheid für 2021 erlassen hat, in dem es die Umsätze aus dem Betrieb der im Jahr 2021 noch steuerpflichtigen Photovoltaikanlage erhöht hat. Streitig ist derzeit, ob die im Jahr 2025 gezahlte Umsatzsteuer als Betriebsausgabe abgezogen werden kann, weil sie das Jahr 2021 betrifft, oder ob sie nicht abziehbar ist, weil im Jahr der Zahlung, also 2025, bereits die Steuerfreiheit gilt, so dass auch Ausgaben steuerlich nicht mehr berücksichtigt werden können.
19. Hinzuschätzungen aufgrund der Richtsatzsammlung
Stellt der Außenprüfer Buchführungsmängel fest, kann es zu einer Hinzuschätzung kommen. Dabei stützt sich das Finanzamt häufig auf die sog. Richtsatzsammlung der Finanzverwaltung, in der diese die Rohgewinnaufschläge der einzelnen Branchen dokumentiert. Der BFH hat zum wiederholten Mal erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit der Richtsatzsammlung geäußert, so dass eine Hinzuschätzung auf der Grundlage der Richtsatzsammlung nicht akzeptiert, sondern angefochten werden sollte.
Hinweis: Die Zweifel ergeben sich insbesondere daraus, dass nur diejenigen Betriebe mit ihren Aufschlagsätzen in die Richtsatzsammlung eingehen, die vom Finanzamt geprüft werden. Außerdem gehen die Zahlen von Verlustbetrieben nicht in die Richtsatzsammlung ein. Schließlich ergeben sich aus der Richtsatzsammlung auch zum Teil sehr weite Spannen bei den Aufschlagsätzen, so dass das Finanzamt den von ihm gewählten Rohgewinnaufschlagsatz nachvollziehbar begründen muss.
20. Rückgängigmachung der Verkürzung von Aufbewahrungsfristen für Banken
Die Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege bei Banken, Versicherungen und Wertpapierinstituten soll künftig wieder zehn Jahre betragen. Zwar wurde erst im Jahr 2024 eine Verkürzung der Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege auf acht Jahre beschlossen, die für Banken, Versicherungen und Wertpapierinstitute ein Jahr später in Kraft treten sollte als für alle anderen Steuerpflichtigen. Nunmehr soll diese Verkürzung der Aufbewahrungsfrist für Banken, Versicherungen und Wertpapierinstitute jedoch wieder rückgängig gemacht werden.
Hinweis: Die Maßnahme soll der Bekämpfung von Steuerhinterziehung dienen und eine bessere Aufklärung von komplexen Finanztransaktionen ermöglichen, wie sie beispielsweise bei Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften vorkommen. Das der geplanten Änderung zugrunde liegende Gesetz soll Ende des Jahres verabschiedet werden. Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir Sie hierüber informieren.
Für alle anderen Steuerpflichtigen bleibt es bei der Verkürzung der Aufbewahrungsfrist auf acht Jahre. Die Verkürzung beschränkt sich auf Buchungsbelege, zu denen z. B. Rechnungen, Quittungen, Auftragszettel oder Bankauszüge gehören. Sie gilt nicht für die Bücher, Aufzeichnungen oder Jahresabschlüsse. Hier bleibt es bei einer Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren.
21. Investitionsabzugsbetrag
Beträgt der Gewinn eines Unternehmens maximal 200.000 €, kann der Unternehmer für geplante Investitionen in abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 50 % der voraussichtlichen Anschaffungs-/Herstellungskosten des Wirtschaftsguts gewinnmindernd bilden, höchstens aber in Höhe von 200.000 € pro Betrieb.
Hinweis: Die Anschaffung oder Herstellung des geplanten Wirtschaftsguts muss innerhalb der nächsten 3 Jahre nach Bildung des Investitionsabzugsbetrags erfolgen. Anderenfalls muss der Investitionsabzugsbetrag rückgängig gemacht werden.
22. Häusliches Arbeitszimmer und Homeoffice-Pauschale
Unternehmer können die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer oder eine sog. Homeoffice-Pauschale für häusliche Büroarbeit steuerlich geltend machen. Zu den Einzelheiten s. Abschn. III. 5.
23. Steuerpflicht von Influencern
Die Finanzverwaltung will die Besteuerung von Influencern und anderen Social-Media-Akteuren sicherstellen und insbesondere professionelle Influencer verstärkt überprüfen. Neben der Einkommen- und Gewerbesteuer (ggf. nach Abzug eines gewerbesteuerlichen Freibetrags von 24.500 €) kann es zur Festsetzung von Umsatzsteuer kommen, wenn der Influencer kein Kleinunternehmer ist, weil er im Vorjahr einen Umsatz von mehr als 25.000 € erzielt hat und sein Umsatz im laufenden Jahr 100.000 € überschreitet.
24. Übergangsfrist für elektronische Rechnungen
Seit dem 1.1.2025 sind Unternehmer verpflichtet, über Leistungen an andere Unternehmer eine elektronische Rechnung auszustellen. Bis zum 31.12.2026 gilt für die Übermittlung der E-Rechnung noch eine Übergangsfrist: Bis zum 31.12.2026 kann der Unternehmer, wie bisher, die Rechnung in Papierform oder – bei Zustimmung des Empfängers – per E-Mail mit Rechnungsanhang übermitteln. Zudem gilt eine entsprechende Übergangsfrist für Umsätze des Jahres 2027 bis zum 31.12.2027, wenn sich der Umsatz im Vorjahr 2026 auf maximal 800.000 € belaufen hat.
Hinweise: Mit dem Begriff der elektronischen Rechnung ist nicht die elektronische Übermittlung per E-Mail gemeint, sondern die Erstellung der Rechnung in einem sog. strukturierten elektronischen Format, das elektronisch ausgewertet und in einem europäischen Meldesystem erfasst werden kann.
Rechnungen an Privatpersonen können auch weiterhin in Papierform oder per E-Mail übermittelt werden.
Die Übergangsregelungen gelten nicht für den Rechnungsempfang. Ein Unternehmer muss unabhängig von den Übergangsfristen ab dem 1.1.2025 zum Empfang einer elektronischen Rechnung in der Lage sein.
25. Vorsteuerabzug aus der Rechnung eines Ist-Versteuerers
Noch kein Handlungsbedarf besteht für den Vorsteuerabzug aus der Rechnung eines sog. Ist-Versteuerers. Zwar hat sich die Rechtslage geändert, weil der Vorsteuerabzug aus einer ordnungsgemäßen Rechnung eines Ist-Versteuerers erst dann möglich sein wird, wenn der Leistungs- und Rechnungsempfänger an den leistenden Ist-Versteuerer und Rechnungsaussteller zahlt; das Inkrafttreten der Regelung ist aber um zwei Jahre auf 2028 verschoben worden und gilt daher erst für Rechnungen, die nach dem 31.12.2027 ausgestellt werden.
Hinweis: Der leistende Ist-Versteuerer ist deshalb auch erst ab dem 1.1.2028 verpflichtet, in seiner Rechnung darauf hinzuweisen, dass er die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten berechnet. Auf diese Weise erfährt der Rechnungsempfänger davon, dass er die Vorsteuer erst geltend machen kann, wenn er die Rechnung bezahlt.
26. Senkung des Umsatzsteuersatzes in der Gastronomie
Voraussichtlich gute Nachrichten gibt es für Gastwirte und die Systemgastronomie: Zum 1.1.2026 soll der Umsatzsteuersatz auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen dauerhaft auf 7 % gesenkt werden. Dies betrifft die Umsätze aus dem Verkauf von Speisen (also ohne Getränkeausschank), unabhängig davon, ob sie im Restaurant verzehrt oder mitgenommen werden.
Hinweis: Die Verabschiedung dieser Neuerung ist zum Ende des Jahres geplant. Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir hierüber informieren.
27. Freiberufliche Einkünfte einer Personengesellschaft
Für freiberuflich tätige Personengesellschaften gibt es eine erfreuliche Entscheidung des BFH. Eine Personengesellschaft ist danach auch dann freiberuflich im steuerlichen Sinne tätig, wenn sich einer ihrer Gesellschafter ganz überwiegend um die kaufmännische Führung der Personengesellschaft kümmert und nur äußerst geringfügig freiberuflich tätig wird. Die Personengesellschaft unterliegt dann nicht der Gewerbesteuer.
An sich erfordert die Freiberuflichkeit, dass an der Personengesellschaft nur Freiberufler beteiligt sind und dass diese auch tatsächlich jeweils eine freiberufliche Tätigkeit ausüben. Bei einer größeren Personengesellschaft – in dem vom BFH entschiedenen Fall waren es sieben Gesellschafter – gehört aber auch die kaufmännische Führung und Organisation der Personengesellschaft zur freiberuflichen Tätigkeit, so dass auch ein überwiegend kaufmännisch tätiger Gesellschafter, der Angehöriger der freien Berufe ist, freiberuflich tätig sein kann.
Hinweis: Da der kaufmännisch tätige Gesellschafter nach der aktuellen BFH-Entscheidung „äußerst geringfügig“ freiberuflich tätig sein muss, ist darauf zu achten, dass er regelmäßig einzelne Aufträge selbst ausführt und – z. B. als Arzt – Patienten selbst behandelt oder zumindest berät und dass dies auch dokumentiert wird. Ist es dem kaufmännisch tätigen Gesellschafter voraussichtlich nicht möglich, geringfügig selbst freiberuflich tätig zu sein, kann es aus steuerlicher Sicht sinnvoll sein, die kaufmännischen Aufgaben einem angestellten Geschäftsführer zu übertragen.
28. Beginn der sachlichen Gewerbesteuerpflicht
Bei Einzelunternehmern und Personengesellschaften beginnt die sachliche Gewerbesteuerpflicht nach der aktuellen BFH-Rechtsprechung erst mit der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit, bei einem Grundstücksunternehmen also erst mit dem Kauf des ersten Grundstücks oder bei einem Hotelbetrieb erst mit der Eröffnung des Hotels, und nicht schon mit dem Bau des Hotels.
Verluste, die vorher anfallen, etwa aus Vorbereitungshandlungen wie der Besichtigung von Grundstücken, werden gewerbesteuerlich daher bei einem Einzelunternehmen oder einer Personengesellschaft nicht berücksichtigt.
Hinweis: Hingegen beginnt bei einer Kapitalgesellschaft die sachliche Gewerbesteuerpflicht spätestens mit Beginn der Eintragung im Handelsregister. Werden hohe Anlaufverluste vor dem Beginn der eigentlichen Tätigkeit erwartet, kann es daher sinnvoll sein, statt eines Einzelunternehmens oder einer Personengesellschaft eine Kapitalgesellschaft zu gründen, weil sich bei dieser die Anlaufverluste gewerbesteuerlich auswirken. Ggf. kann später eine Einbringung des Betriebs der Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft in Betracht gezogen werden, auf die der gewerbesteuerliche Verlust aus der Anlaufphase übergeht.
II. Kapitalgesellschaften und ihre Gesellschafter
1. Unentgeltliche Übertragung eigener Anteile auf die Gesellschafter
Hält eine GmbH eigene Anteile und überträgt sie diese unentgeltlich auf einen Gesellschafter, führt dies dem Grunde nach zu einer verdeckten Gewinnausschüttung. Denn dem BFH zufolge ist die Unentgeltlichkeit durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst. Beim Gesellschafter führt die verdeckte Gewinnausschüttung zu Einnahmen aus Kapitalvermögen.
Handelt es sich jedoch um einen Alleingesellschafter, der bislang alle weiteren Anteile – außer den von der GmbH selbst gehaltenen eigenen Anteilen – gehalten hat, kann der Wert der hinzuerworbenen Anteile (eigene Anteile der GmbH) und damit die Höhe der verdeckten Gewinnausschüttung sehr niedrig sein. Nach Auffassung des BFH gewinnt ein Alleingesellschafter durch den Erwerb der eigenen Anteile von der GmbH nichts Substantielles hinzu, weil er bereits vor der Übertragung faktischer Alleingesellschafter war.
Hinweis: Nach Auffassung des BFH ist in jedem Fall eine Mehrfachbesteuerung zu vermeiden. Eine Mehrfachbesteuerung könnte entstehen, wenn zunächst eine verdeckte Gewinnausschüttung beim Gesellschafter angesetzt wird und er anschließend die erworbenen eigenen Anteile veräußert und damit einen Veräußerungsgewinn versteuern muss, weil er von seinem Veräußerungserlös nur Anschaffungskosten in Höhe von 0 € (wegen der unentgeltlichen Übertragung) abziehen kann.
2. Minderung des Körperschaftsteuersatzes
Der Körperschaftsteuersatz, der derzeit 15 % beträgt, wird künftig gesenkt werden. Die Senkung wird allerdings erst ab dem Veranlagungszeitraum 2028 wirksam werden: Der Körperschaftsteuersatz wird dann auf 14 % und anschließend jährlich um jeweils einen weiteren Prozentpunkt gesenkt, bis er ab dem Veranlagungszeitraum 2032 nur noch 10 % betragen wird.
Hinweis: Ein Körperschaftsteuersatz von 10 % klingt niedrig. Zu beachten ist jedoch, dass auch die spätere Ausschüttung an den Gesellschafter von diesem grundsätzlich noch mit der Abgeltungsteuer von 25 % versteuert werden muss. Außerdem muss eine Kapitalgesellschaft auch Gewerbesteuer zahlen, die – je nach dem Hebesatz der Gemeinde – im Bundesdurchschnitt rund 14 % beträgt.
3. Forderungsverzicht mit Besserungsabrede
Befindet sich eine GmbH in finanziellen Schwierigkeiten, sollte neben einem Rangrücktritt (s. o. Abschn. I. 8) ein Gläubigerverzicht angestrebt werden, insbesondere wenn der Gläubiger zugleich Gesellschafter der GmbH ist. Der Forderungsverzicht kann auch mit einer sog. Besserungsabrede verbunden werden, so dass die Forderung des Gläubigers bzw. Gesellschafters wieder auflebt, wenn es der GmbH finanziell wieder besser geht.
Sowohl ein Forderungsverzicht (ohne Besserungsabrede) als auch ein Forderungsverzicht mit Besserungsabrede können sich beim Gesellschafter steuerlich auswirken. Dem BFH zufolge ergeben sich beim Gesellschafter zunächst Verluste aus Kapitalvermögen, wenn das Darlehen ab dem 1.1.2009 gewährt worden ist und soweit die Darlehensforderung des Gesellschafters wertlos war. Der Verlust aus Kapitalvermögen entsteht in dem Jahr des Forderungsverzichts (mit Besserungsabrede).
Verkauft der mit mindestens 1 % beteiligte Gesellschafter in einem Folgejahr seine Beteiligung oder gibt er sie auf, kann bei ihm ein Veräußerungs- bzw. Aufgabeverlust entstehen, in den auch der Verlust der Darlehensforderung aufgrund des Forderungsverzichts (mit Besserungsabrede) eingeht. Hierzu gehört der werthaltige Teil der Darlehensforderung im Zeitpunkt des Forderungsverzichts, zusätzlich aber auch der wertlose Teil seiner Forderung, wenn das Darlehen von vornherein krisenbestimmt war oder soweit das Darlehen im Zeitpunkt des Kriseneintritts stehen gelassen wurde und im Zeitpunkt des Stehenlassens noch werthaltig war.
Hinweis: Im Ergebnis kann es damit zu einer teilweisen Doppelberücksichtigung des Verlustes der Darlehensforderung kommen, die im Jahr der Aufgabe bzw. Veräußerung der Beteiligung verfahrensrechtlich rückgängig zu machen ist.
Wird eine im Umfang von mindestens 1 % bestehende GmbH-Beteiligung (sog. wesentliche Beteiligung) noch im Jahr des Forderungsverzichts (mit Besserungsabrede) veräußert oder aufgegeben, wird kein Verlust aus Kapitalvermögen berücksichtigt, weil Kapitaleinkünfte gegenüber den Einkünften aus dem Verkauf oder der Aufgabe einer wesentlichen GmbH-Beteiligung nachrangig sind, die kraft Gesetzes als gewerbliche Einkünfte angesehen werden.
Der Ansatz eines Verlustes aus Kapitalvermögen nützt dem Gesellschafter nach der aktuellen Rechtslage nicht viel, weil negative Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht mit positiven Einkünften anderer Einkunftsarten verrechnet werden können.
Die steuerliche Berücksichtigung eines Darlehensausfalls bei den gewerblichen Einkünften eines GmbH-Gesellschafters (Verkauf oder Aufgabe einer wesentlichen GmbH-Beteiligung) setzt grundsätzlich eine unmittelbare Beteiligung an der GmbH voraus. Bei einer nur mittelbaren Beteiligung kann der Darlehensausfall nur bei den Einkünften aus Kapitalvermögen berücksichtigt werden; der Steuerpflichtige muss dann mit Einkünfteerzielungsabsicht gehandelt haben, also ein verzinsliches Darlehen gewährt haben. Dies hat das FG Düsseldorf entschieden, dessen Urteil noch nicht rechtskräftig ist.
4. Umsatztantieme an Minderheitsaktionär
Zwar werden Umsatztantiemen an Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH im Allgemeinen steuerrechtlich nicht anerkannt. Anders ist dies jedoch bei einer AG, wenn die AG einem Vorstandsmitglied, der Minderheitsaktionär ist, eine Umsatztantieme gewährt. Nach einer aktuellen Entscheidung des BFH ist grundsätzlich keine verdeckte Gewinnausschüttung anzunehmen, da die Interessen der AG bei einer Vereinbarung mit einem Vorstandsmitglied durch den Aufsichtsrat gewahrt werden; der Aufsichtsrat vertritt nämlich die AG beim Abschluss der Tantiemevereinbarung.
Hinweis: Anders kann dies sein, wenn der Aufsichtsrat mit nahestehenden Personen des Vorstandsmitglieds und Minderheitsaktionärs besetzt ist oder wenn das Vorstandsmitglied ein Mehrheitsaktionär ist, der aufgrund seiner Stimmenmehrheit in der Hauptversammlung die Möglichkeit hat, ihm wohlgesinnte Aufsichtsratsmitglieder zu wählen.
5. Inkongruente Gewinnausschüttung
Bei einer GmbH kann es aus steuerlicher Sicht sinnvoll sein, die Gewinnausschüttung abweichend von der Beteiligungsquote vorzunehmen (sog. inkongruente Gewinnausschüttung). Auf diese Weise können z. B. unterschiedliche Steuersätze der Gesellschafter ausgenutzt werden.
Eine inkongruente Gewinnausschüttung wird vom BFH sowie von der Finanzverwaltung anerkannt,
- wenn sie im Gesellschaftsvertrag vereinbart wird oder
- wenn der Gesellschaftsvertrag eine Öffnungsklausel enthält, nach der eine inkongruente Gewinnverteilung beschlossen werden kann, und der Beschluss dann mit der im Gesellschaftsvertrag bestimmten Mehrheit gefasst wird oder
- wenn sie einstimmig für nur ein Jahr beschlossen wird und damit nicht anfechtbar ist (sog. punktuelle Satzungsdurchbrechung); ein derartiger einstimmiger Beschluss kann im nächsten Jahr wiederholt werden, darf sich dann aber ebenfalls nur auf ein Wirtschaftsjahr beziehen.
6. Option zur Körperschaftsteuer von Personengesellschaften
Personengesellschaften können einen Antrag auf Option zur Körperschaftsteuer stellen. Ihr Gewinn wird dann lediglich mit einem Körperschaftsteuersatz von 15 % zuzüglich Gewerbesteuer besteuert.
Hinweis: Grundsätzlich ist die Option bis zum 30.11. zu beantragen, damit sie für das Folgejahr gilt. Neugegründete Personengesellschaften können den Antrag aber innerhalb eines Monats nach Abschluss des Gesellschaftsvertrags stellen, so dass die Option von Beginn der Tätigkeit an gilt.
7. Allgemeine Hinweise zu Kapitalgesellschaften
Verträge zwischen der Kapitalgesellschaft und ihren Gesellschaftern sollten auf ihre Fremdüblichkeit, insbesondere Angemessenheit, und tatsächliche Durchführung überprüft werden, um eine verdeckte Gewinnausschüttung zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Geschäftsführer-, Miet- oder Darlehensverträge sowie für ein Verrechnungskonto, welches angemessen verzinst werden sollte.
8. Geplante Änderungen bei der Gemeinnützigkeit
Für den Bereich der steuerlichen Gemeinnützigkeit sind zahlreiche Änderungen geplant, die zum 1.1.2026 in Kraft treten sollen. Die Verabschiedung des Gesetzes wird voraussichtlich Ende des Jahres erfolgen. Sollte sich hieran etwas ändern, werden wir Sie informieren.
So soll der sog. E-Sport, also der Wettkampf in Video- und Onlinespielen, künftig als Sport im gemeinnützigen Sinne gelten. Der E-Sport würde damit ebenso als gemeinnützig behandelt werden wie Schach, das auch als Sport für Zwecke der Gemeinnützigkeit gilt. Die Neuregelung soll jedoch nicht für gewaltverherrlichende Videospiele gelten.
Hinweis: Die geplante Erweiterung der Gemeinnützigkeit auf den E-Sport ist für Vereine interessant, die zusätzlich zum herkömmlichen Bewegungssport wie etwa Fußball auch noch E-Sport anbieten wollen, um auf diese Weise neue Mitglieder zu gewinnen.
Gemindert werden sollen die Anforderungen an die sog. Selbstlosigkeit. Gemeinnützige Vereine sind verpflichtet, ihre Mittel möglichst zügig für steuerbegünstigte Satzungszwecke auszugeben. Bislang greift eine Freigrenze von 45.000 €, so dass Vereine, deren jährliche Einnahmen diesen Betrag nicht überschreiten, von der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung befreit sind. Diese Grenze soll auf 100.000 € erhöht werden.
Künftig sollen gemeinnützige Vereine auch Photovoltaikanlagen oder andere Anlagen für erneuerbare Energien (z. B. mittels Windkraft oder Geothermie) errichten und betreiben können, ohne dass dies die steuerliche Gemeinnützigkeit gefährdet. Der Gesetzgeber hofft, dass der verstärkte Einsatz derartiger Anlagen das Risiko von Umweltkatastrophen mindert.
Viele Vereine unterhalten neben ihrem eigentlichen gemeinnützigen Bereich auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der steuerlich nicht als gemeinnützig erfasst wird, sondern dessen Einnahmen zu versteuern sind. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb umfasst Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen, die nicht unmittelbar den gemeinnützigen Zwecken dienen z. B. die Veranstaltung eines Basars oder der Verkauf von Speisen und Getränken. Bislang gilt für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe eine Freigrenze in Höhe von 45.000 € (einschließlich Umsatzsteuer) pro Jahr. Diese Freigrenze soll nun auf 50.000 € (einschließlich Umsatzsteuer) jährlich angehoben werden.
Hinweis: Bis zur Höhe der Freigrenze fallen weder Körperschaft- noch Gewerbesteuer an. Da es sich um eine Freigrenze und nicht um einen Freibetrag handelt, entsteht Körperschaft- und Gewerbesteuer jedoch auf den gesamten Gewinn, sobald die Freigrenze auch nur um 1 € überschritten wird.
Ferner soll es zu einer sog. Zuordnungsvereinfachung kommen. Belaufen sich die Einnahmen aus allen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben auf maximal 50.000 € im Jahr, soll künftig keine Verpflichtung mehr bestehen, die Einnahmen den einzelnen Bereichen der gemeinnützigen Körperschaft (ideeller, also gemeinnütziger Bereich, Vermögensverwaltung, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und Zweckbetrieb) zuzuordnen; denn bis zu dieser Grenze entsteht ohnehin keine Körperschaft- oder Gewerbesteuer.
III. Arbeitgeber/Arbeitnehmer
1. Leasing-Sonderzahlung eines Außendienstmitarbeiters für Kfz
Nutzt ein Außendienstmitarbeiter einen geleasten Pkw und entrichtet er eine Leasing-Sonderzahlung, muss er die Leasing-Sonderzahlung für die Berechnung der Kilometerkosten nach der geänderten Rechtsprechung des BFH auf die Dauer des Leasingvertrags verteilen. Die Sonderzahlung erhöht also nicht in vollem Umfang seine Kilometerkosten im ersten Jahr. Insbesondere kann er den auf diese Weise ermittelten Kilometersatz nicht in den Folgejahren anwenden.
Beispiel: A ist Außendienstmitarbeiter und least ab 2024 ein Kfz für drei Jahre. Er leistet im Dezember 2024 eine Leasing-Sonderzahlung in Höhe von 15.000 €. Zur Ermittlung der tatsächlichen Kfz-Kosten für 2024 setzt er die Leasing-Sonderzahlung im vollen Umfang an und ermittelt auf diese Weise unter Zugrundelegung seiner jährlichen Fahrleistung einen Betrag von 0,93 € pro gefahrenen Kilometer. Diesen Kilometersatz wendet er nicht nur in seiner Einkommensteuererklärung für 2024, sondern auch in den Folgejahren an.
Lösung: Diese Berechnung wird nicht anerkannt. A muss die Leasing-Sonderzahlung für die Ermittlung der Kfz-Kosten auf den dreijährigen Leasingzeitraum verteilen, sodass für 2024 ein Anteil von 5.000 € (1/3 von 15.000 €) in die Berechnung der Kfz-Kosten einfließt. Für die beiden Folgejahre müssen die Kfz-Kosten erneut ermittelt werden. Auch hier dürfen lediglich je 5.000 € als Anteil an der Leasing-Sonderzahlung einbezogen werden.
Gleiches gilt für die Kosten der Sonderausstattung, die sich auf den Leasing-Zeitraum erstrecken (z. B. Kosten für einen weiteren Reifensatz). Auch diese Aufwendungen sind auf den Leasing-Zeitraum zu verteilen.
2. Vom Arbeitnehmer für den Dienstwagen übernommene Kosten
Darf der Arbeitnehmer einen Dienstwagen auch für private Fahrten nutzen, muss er einen geldwerten Vorteil versteuern, der sich in der Regel nach der sog. 1 %-Methode berechnet, so dass monatlich 1 % des Bruttolistenpreises (zzgl. Kosten der Sonderausstattung) versteuert werden müssen.
Dieser geldwerte Vorteil kann sich im Falle von Zuzahlungen des Arbeitnehmers mindern. Hierbei darf es sich dem BFH zufolge jedoch nicht um Zuzahlungen für Kosten handeln, die ausschließlich für Privatfahrten angefallen sind. Vielmehr müssten die vom Arbeitnehmer getragenen Aufwendungen für den Fall, dass der Arbeitgeber sie getragen hätte, von der Abgeltungswirkung der 1 %-Methode erfasst werden. Dies war in den aktuell vom BFH entschiedenen Fällen bei den vom jeweiligen Arbeitnehmer übernommenen Maut-, Park- und Fährkosten bei privaten Urlaubsfahrten nicht der Fall; hätte der Arbeitgeber diese Kosten übernommen, hätten die Zahlungen zusätzlich zu dem nach der 1 %-Methode ermittelten geldwerten Vorteil vom Arbeitnehmer versteuert werden müssen.
Hinweis: Der geldwerte Nutzungsvorteil wird jedoch gemindert, wenn der Arbeitnehmer entweder Nutzungsentgelte an den Arbeitgeber für die private Nutzung des Dienstwagens entrichtet oder wenn er für einen bestimmten Zeitraum eine Einmalzahlung für die private Nutzung leistet oder wenn er einen Teil der Anschaffungskosten für den Dienstwagen trägt.
3. Übertragung von GmbH-Anteilen auf leitende Angestellte im Rahmen der Unternehmensnachfolge
Grundsätzlich führt die unentgeltliche Übertragung von Anteilen an der Arbeitgeber-GmbH auf Arbeitnehmer zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Anders kann dies nach einer aktuellen BFH-Entscheidung sein, wenn die GmbH-Gesellschafter Eheleute sind und die Geschäftsführung an ihren Sohn abgeben und zugleich den leitenden Angestellten unentgeltlich GmbH-Anteile übertragen, damit diese den Sohn als neuen Geschäftsführer im Rahmen der Unternehmensnachfolge unterstützen. Es liegt dann kein Arbeitslohn für die leitenden Angestellten vor, weil die Übertragung der Anteile auf sie nicht durch das Arbeitsverhältnis, sondern vielmehr durch die Regelung der Unternehmensnachfolge veranlasst ist.
Gegen die Annahme von Arbeitslohn spricht auch, wenn der Wert der übertragenen GmbH-Anteile deutlich höher ist als das Jahresgehalt des Arbeitnehmers oder wenn alle Arbeitnehmer Anteile im gleichen Wert erhalten, obwohl ihre Beschäftigungsdauer und Vergütung unterschiedlich sind. Ferner kann es gegen die Annahme von Arbeitslohn sprechen, wenn die Anteilsübertragungen nicht an den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses geknüpft sind.
Hinweis: Derartige Anteilsübertragungen an Arbeitnehmer können der Schenkungsteuer unterliegen. Hier kommt eine schenkungsteuerliche Begünstigung für die Übertragung von Betriebsvermögen in Betracht.
4. Umzugskosten bei erstmaliger Nutzung eines Arbeitszimmers
Schlechte Nachrichten gibt es für Arbeitnehmer, die in eine größere Wohnung umziehen und dort erstmals ein häusliches Arbeitszimmer einrichten. Dem BFH zufolge sind die Umzugskosten nicht als Werbungskosten abziehbar, weil der Umzug auch privat veranlasst ist. Dem BFH genügt es nicht, dass jedenfalls seit der Corona-Krise zunehmend mehr Arbeit im häuslichen Arbeitszimmer zu erbringen ist.
Umzugskosten sind hingegen als Werbungskosten abziehbar, wenn sich aufgrund des Umzugs die tägliche Fahrzeit zur Arbeit um mindestens eine Stunde verkürzt oder wenn es um den Auszug aus einer Dienstwohnung bzw. um den Einzug in eine Dienstwohnung geht.
Hinweis: Der BFH lehnt lediglich die Anerkennung der Umzugskosten als Werbungskosten ab. Die Kosten für die Einrichtung des neuen häuslichen Arbeitszimmers sowie die laufenden Kosten für das Arbeitszimmer sind dem Grunde nach als Werbungskosten abziehbar, s. folgenden Beitrag.
5. Häusliches Arbeitszimmer
Arbeitnehmer können die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer in tatsächlicher Höhe abziehen, wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. Anstelle der tatsächlichen Aufwendungen kann eine Jahrespauschale von 1.260 € ohne weiteren Nachweis abgezogen werden.
Verfügt der Arbeitnehmer nicht über ein häusliches Arbeitszimmer, sondern nutzt er bspw. lediglich eine Arbeitsecke im Wohn- oder Schlafzimmer, kann er die sog. Home-Office-Pauschale von 6 € pro Tag, maximal 1.260 € im Jahr geltend machen. Der Arbeitnehmer erhält die Tagespauschale für jeden Tag, an dem er seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit überwiegend in der Wohnung ausübt und nicht in den Betrieb (d. h. zur ersten Tätigkeitsstätte) fährt.
Hinweis: Eine Fahrt in den Betrieb oder auch eine auswärtige Tätigkeit ist unschädlich, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.
6. Dienstwagen
Wird dem Arbeitnehmer ein Dienstwagen überlassen, den er auch privat nutzen darf, muss er einen geldwerten Vorteil versteuern, der grundsätzlich nach der sog. 1 %-Methode ermittelt wird. Der geldwerte Vorteil wird dann mit 1 % des Bruttolistenpreises zuzüglich Sonderausstattungen als steuerpflichtiger Vorteil monatlich bewertet.
Bei Hybridfahrzeugen mindert sich der Entnahmewert auf 0,5 % des Bruttolistenpreises monatlich, sofern das Fahrzeug gewisse Anforderungen hinsichtlich seiner Reichweite oder des CO2-Ausstoßes erfüllt. Bei reinen Elektrofahrzeugen mindert sich der Entnahmewert auf bis zu 0,25 % des Bruttolistenpreises, sofern dieser einen gewissen Höchstbetrag nicht übersteigt.
Hinweis: Für die Minderung des Bruttolistenpreises auf 0,25 % bei reinen Elektrofahrzeugen galt zuletzt eine Preisgrenze von 70.000 €, die auf 100.000 € erhöht worden ist. Die neue Grenze gilt erstmals für Elektrofahrzeuge, die nach dem 30.6.2025 angeschafft werden.
Alternativ kann der geldwerte Vorteil auch nach der sog. Fahrtenbuchmethode ermittelt werden, indem die Privatfahrten anhand eines ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuchs nachgewiesen werden. Maßgeblich sind dann die auf die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen, in die die Anschaffungs- und Betriebskosten für das Kfz eingehen. Die Anschaffungskosten werden bei Hybridfahrzeugen unter bestimmten Voraussetzungen in Bezug auf Reichweite und CO2-Ausstoß lediglich zu 50 % und bei reinen Elektrofahrzeugen – sofern die Preisgrenze von 100.000 € (Anschaffung nach dem 30.6.2025) bzw. von zuletzt 70.000 € nicht überschritten wird – nur zu 25 % angesetzt.
7. Doppelte Haushaltsführung
Verbessert hat sich die Situation für Arbeitnehmer, die die Kosten für eine doppelte Haushaltsführung steuerlich geltend machen wollen und im Wohnhaus ihrer Eltern einen eigenen Haushalt führen. Dem BFH zufolge setzt die doppelte Haushaltsführung in einem solchen Fall nicht voraus, dass sich der Arbeitnehmer an den Lebensführungskosten der Eltern beteiligt. Eine Kostenbeteiligung ist nur dann erforderlich, wenn mehrere Personen einen gemeinsamen Haushalt führen. Einen eigenen Haushalt des Arbeitnehmers im Haus seiner Eltern wird man insbesondere dann annehmen können, wenn der Arbeitnehmer Räume bewohnt, die ausschließlich ihm zur Verfügung stehen. Auch können das Alter des Arbeitnehmers und seine finanzielle Unabhängigkeit für das Führen eines eigenen Haushaltes sprechen.
Hinweis: Die eigene Haushaltsführung im Haus der Eltern setzt nicht unbedingt voraus, dass es sich bei dem vom Arbeitnehmer bewohnten Bereich um eine abgeschlossene Wohnung handelt. Es genügt, wenn der Bereich abgrenzbar ist, sich z. B. im Obergeschoss des Einfamilienhauses der Eltern befindet und die Räumlichkeiten nach ihrer Größe und Ausstattung ein eigenständiges Wohnen und Wirtschaften gestatten.
8. Erhöhung der Entfernungspauschale
Die Entfernungspauschale, die für Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte gilt, soll ab dem 1.1.2026 von 0,30 € pro Entfernungskilometer auf 0,38 € ab dem ersten Entfernungskilometer erhöht werden. Diese Erhöhung soll auch für Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung gelten.
Hinweis: Aktuell gilt – befristet für die Veranlagungszeiträume 2022 bis 2026 – eine Entfernungspauschale von 0,38 € für Entfernungen erst ab dem 21. Entfernungskilometer, während für die ersten 20 Entfernungskilometer eine Entfernungspauschale von 0,30 € anzusetzen ist. Der Neuregelung zufolge würde damit eine einheitliche Entfernungspauschale von 0,38 €, unabhängig von der Entfernung, gelten. Das Gesetz soll Ende des Jahres verabschiedet werden. Sollten sich an den geplanten Regelungen Änderungen ergeben, werden wir Sie informieren.
9. Mobilitätsprämie
Arbeitnehmer mit geringem Einkommen und einem längeren Arbeitsweg haben seit dem Veranlagungszeitraum 2021 einen Anspruch auf die sog. Mobilitätsprämie, die bislang bis 2026 befristet ist. Der Gesetzgeber will die Mobilitätsprämie nun unbefristet ausgestalten. Sollte die Regelung nicht umgesetzt werden, werden wir Sie ebenfalls hierüber in Kenntnis setzen.
10. Mindestlohn und Minijobs
Der allgemeine gesetzliche Mindestlohn in Deutschland wird ab dem 1.1.2026 von 12,82 € brutto/Stunde auf 13,90 € brutto/Stunde steigen. Die Bundesregierung hat eine entsprechende Empfehlung der Mindestlohnkommission umgesetzt. Damit verbunden ist auch eine Erhöhung der Minijob-Grenze von 556 €/Monat auf 603 €/Monat. Die Jahresverdienstgrenze liegt dann bei 7.236 €.
Hinweis: Die Anpassung des Mindestlohns lässt laufende Tarifverträge im Wesentlichen unberührt. Der Mindestlohn gilt darüber hinaus u. a. nicht für Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz, Pflichtpraktikanten im Rahmen einer Schul-, Hochschulausbildung oder eines Freiwilligendienstes, Absolventen eines freiwilligen Praktikums bis zu drei Monaten, Personen, die einen freiwilligen Dienst ableisten und grundsätzlich auch nicht für ehrenamtlich Tätige.
IV. Vermieter
1. Abschreibungen auf Gebäude
Auf vermietete Gebäude im Privatvermögen kann eine jährliche Abschreibung in Höhe von 3 % in gleichen Jahresbeträgen in Anspruch genommen werden, wenn das Gebäude nach dem 31.12.2022 fertiggestellt worden ist; anderenfalls beträgt die Abschreibung 2 % (bzw. 2,5 % bei historischen Gebäuden mit Fertigstellung vor dem 1.1.1925). Eine höhere Abschreibung wegen einer tatsächlich kürzeren Nutzungsdauer ist möglich, wenn die tatsächlich kürzere Nutzungsdauer durch ein Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken nachgewiesen wird. Der Gutachter muss das Grundstück nach einer geplanten Neuregelung künftig zuvor besichtigt haben (Einzelheiten s. Abschn. I. 16.).
Bei Erwerb eines bebauten Grundstücks, das vermietet wird bzw. vermietet werden soll, ist die geplante gesetzliche Änderung zur Kaufpreisaufteilung zu beachten, Einzelheiten hierzu s. Abschn. I. 15.
Unverändert gültig ist die degressive Abschreibung in Höhe von 5 % vom jeweiligen Buchwert (Restbuchwert) für vermietete neue Wohngebäude. Voraussetzung ist, dass mit der Herstellung nach dem 30.9.2023 und vor dem 1.10.2029 begonnen worden ist oder dass das Gebäude nach dem 30.9.2023 und vor dem 1.10.2029 gekauft wird und der Nutzen- und Lastenwechsel bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung erfolgt ist. Außerdem muss das Grundstück entweder in Deutschland oder in der EU bzw. im EWR (Island, Liechtenstein und Norwegen) liegen.
Erste Rechtsprechung gibt es in Bezug auf die Sonderabschreibung für neu gebaute Mietwohnungen, bei der der Steuerpflichtige eine Abschreibung von bis zu 5 % jährlich in den ersten vier Jahren (insgesamt also bis zu 20 %) zusätzlich zur linearen Abschreibung in Anspruch nehmen kann. Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung beträgt maximal 4.000 € pro Quadratmeter. Die Voraussetzungen: Der Bauantrag muss nach dem 31.12.2022 und vor dem 1.10.2029 gestellt worden sein bzw. gestellt werden. Im Fall eines Kaufes muss die Anschaffung bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung erfolgen. Die Wohnung muss im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden neun Jahren entgeltlich zu Wohnzwecken vermietet werden. Ferner muss das Gebäude das Qualitätssiegel „Nachhaltiges Gebäude“ für sog. klimafreundliches Bauen aufweisen. Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten pro Quadratmeter Wohnfläche dürfen nicht höher sein als 5.200 €.
Dem BFH zufolge setzt die Sonderabschreibung voraus, dass zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird; sie wird daher nicht gewährt, wenn der Steuerpflichtige ein Gebäude abreißt und ein neues Gebäude errichtet. Erfreulich ist hingegen, dass die Finanzverwaltung bei der Prüfung, ob die Baukostenobergrenze von 5.200 €/qm eingehalten worden ist, auf die Brutto-Grundfläche abstellt, die höher ist als die reine Wohnfläche der Wohnung, weil zur Brutto-Grundfläche z. B. auch Treppenhäuser und Flure zählen.
Bislang werden Photovoltaikanlagen, die auf Gebäuden angebracht werden, selbständig abgeschrieben. Hier muss abgewartet werden, ob sich aufgrund der geänderten handelsbilanzrechtlichen Betrachtung die steuerliche Sichtweise ändert (s. Abschn. I. 9).
2. Schuldzinsenabzug aus Immobilien-Darlehen
Ein Gesellschafter einer Personengesellschaft, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt und damit vermögensverwaltend tätig ist, sollte beachten, dass eine Darlehensgewährung an die Personengesellschaft nach der aktuellen BFH-Rechtsprechung nicht zu Zinsaufwand bei der Personengesellschaft führt, soweit der Gesellschafter an dieser beteiligt ist. Denn in diesem Umfang gewährt der Gesellschafter das Darlehen steuerlich betrachtet an sich selbst.
Beispiel: A ist an der ABC-GbR zu 1/3 beteiligt. Er gewährt der ABC-GbR ein Darlehen in Höhe von 100.000 €, das zu 6 % zu verzinsen ist. Bei der ABC-GbR entsteht dadurch zwar rechnerisch ein Zinsaufwand in Höhe von 6.000 €; der Zinsaufwand ist aber nur zu 4.000 € (2/3) steuerlich als Werbungskosten abziehbar.
Entsprechendes gilt auch für einen Mietvertrag zwischen dem Gesellschafter und seiner vermögensverwaltenden Personengesellschaft. Dieser Mietvertrag wird steuerlich nicht anerkannt, soweit der Gesellschafter an der Personengesellschaft und damit am Grundstück beteiligt ist.
Vorsicht ist nach der aktuellen BFH-Rechtsprechung auch geboten, wenn ein Teil einer fremdfinanzierten Mietimmobilie unentgeltlich auf ein Kind übertragen werden soll und hierdurch eine Grundstücksgemeinschaft gegründet wird. Dann können nämlich die Schuldzinsen, soweit sie auf den übertragenen Teil entfallen und vom Kind nicht übernommen werden, vom bisherigen Eigentümer nicht mehr als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend gemacht werden, obwohl er weiterhin die Zinsen zahlt. Dem BFH zufolge besteht aufgrund der unentgeltlichen Übertragung insoweit kein Zusammenhang mehr zwischen den Schuldzinsen und den Vermietungseinkünften.
Beispiel: V ist Eigentümer einer vermieteten Immobilie, deren Kauf er mit einem Kredit finanziert hat. Zum 1.1.2025 überträgt V auf seinen Sohn S unentgeltlich einen Miteigentumsanteil von 2/5 an der Immobilie, so dass eine Grundstücksgemeinschaft zwischen V und S entsteht. Der Immobilienkredit wird weiterhin von V bedient. Im Jahr 2025 muss V 50.000 € Zinsen an die Bank zahlen.
Lösung: V kann lediglich 30.000 € Schuldzinsen als sog. Sonderwerbungskosten der Grundstücksgemeinschaft steuerlich geltend machen. Den verbleibenden Teil in Höhe von 20.000 € kann er steuerlich nicht absetzen. Auch S kann die Schuldzinsen nicht absetzen, weil er die Schuldzinsen nicht bezahlt hat.
3. Ausgleichszahlungen für einen Zinsswap
Wird ein Immobilienkredit für eine vermietete Immobilie des Privatvermögens durch eine Zinsswap-Vereinbarung abgesichert und muss der Steuerpflichtige negative Ausgleichszahlungen für den Zinsswap zahlen, kann er diese Ausgleichszahlungen nicht als Werbungskosten bei den Vermietungseinkünften absetzen. Dem BFH zufolge handelt es sich um negative Kapitaleinnahmen aus einem Termingeschäft, die nach der gesetzlichen Regelung lediglich beschränkt verrechenbar sind.
4. Einzahlungen in die Instandhaltungsrücklage
Geklärt hat der BFH die Frage, ob Einzahlungen des Eigentümers einer vermieteten Eigentumswohnung in die Instandhaltungsrücklage (Erhaltungsrücklage) der Wohnungseigentümergemeinschaft sofort abziehbar sind oder ob die Mittel – wie bisher – erst bei deren Verwendung als Werbungskosten abgezogen werden können. Hintergrund dieser Frage war eine Reform des Wohnungseigentumsrechts im Jahr 2020, die dazu geführt hat, dass die Instandhaltungsrücklage zivilrechtlich nur noch der Wohnungseigentümergemeinschaft zusteht, jedoch nicht anteilig dem einzelnen Wohnungseigentümer.
Der BFH hat sich nun für eine Beibehaltung der bisherigen Rechtslage entschieden. Das bedeutet, dass wie bisher die Einzahlung in die Instandhaltungsrücklage noch nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung berücksichtigt wird. Zu einem Werbungskostenabzug kommt es erst dann, wenn und soweit die Instandhaltungsrücklage für Erhaltungsmaßnahmen verbraucht wird.
Hinweis: Offen bleibt die Rechtslage für Eigentumswohnungen, die dem Betriebsvermögen zuzuordnen sind. Hier ist noch eine Entscheidung des BFH abzuwarten, s. Abschn. I. 10.
5. Vorsteuerabzug des Vermieters bei Lieferung von Mieterstrom
Gute Nachrichten gibt es für Vermieter, die umsatzsteuerfrei vermieten und ihren Mietern zusätzlich Strom aus einer Photovoltaikanlage gegen Entgelt liefern. Nach einem neueren BFH-Urteil kann der Vermieter die Vorsteuer aus dem Erwerb der Photovoltaikanlage geltend machen.
Im Gegensatz zur Wohnungsvermietung ist die Stromlieferung umsatzsteuerpflichtig, so dass ein Vorsteuerabzug aus der Anschaffung der Photovoltaikanlage möglich ist. Die Stromlieferung ist eine selbständige umsatzsteuerpflichtige Leistung und keine Nebenleistung des umsatzsteuerfreien Mietvertrags, da der Mietvertrag nach dem Gesetz nicht mit einem Energieversorgungsvertrag gekoppelt werden darf.
Hinweis: Anders ist es dem BFH zufolge, wenn ein Wohnungsvermieter eine Heizungsanlage anschafft. Der Vermieter hat dann keinen Vorsteuerabzug, weil die Lieferung der Wärme und des warmen Wassers eine Nebenleistung zur umsatzsteuerfreien Vermietung darstellt. Als Vermieter schuldet er nämlich die Versorgung des Mieters mit Wärme und warmen Wasser, nicht jedoch die Lieferung von Strom.
6. Mietverträge mit nahen Angehörigen
Wird eine Wohnung an einen nahen Angehörigen vermietet, werden das Mietverhältnis und damit einhergehende Werbungskosten nur dann steuerlich anerkannt, wenn der Mietvertrag fremdüblich ist und auch tatsächlich durchgeführt wird. Daher sollte nachgewiesen werden können, dass die Miete bei Fälligkeit gezahlt worden ist. Außerdem sollte die jährliche Betriebskostenabrechnung rechtzeitig erstellt und die entsprechende Nachzahlung bzw. Erstattung pünktlich beglichen worden sein.
Weiterhin ist darauf zu achten, dass die vereinbarte Miete mindestens 66 % der ortsüblichen Vergleichsmiete beträgt, damit die Werbungskosten in vollem Umfang anerkannt werden. Liegt die Miete unter 66 %, aber bei mindestens 50 % der ortsüblichen Miete, prüft das Finanzamt die Einkünfteerzielungsabsicht anhand einer 30-Jahres-Prognose. Fällt diese negativ aus, werden Werbungskosten nur anteilig – entsprechend dem entgeltlichen Teil der Vermietung – berücksichtigt.
Hinweis: Die Prüfung der Miethöhe ist nicht auf Mietverträge mit nahen Angehörigen beschränkt, sondern betrifft auch Mietverträge mit fremden Dritten.
V. Kapitalanleger
1. Nießbrauch an GmbH-Anteilen
Nach der neuen BFH-Rechtsprechung wird ein Nießbrauch an GmbH-Anteilen steuerlich nur dann anerkannt, wenn sich der Nießbrauch auch auf das Stimmrecht und die sonstigen Mitverwaltungsrechte erstreckt und nicht nur auf das Gewinnbezugsrecht.
Erstreckt sich der Nießbrauch lediglich auf das Gewinnbezugsrecht, führt dies zum einen dazu, dass der Anteilseigner – und nicht der Nießbrauchsberechtigte – die Dividenden versteuern muss. Zum anderen ist eine spätere Abfindung, die der Anteilseigner an den Nießbrauchsberechtigten zahlt, damit dieser einer Aufhebung des Nießbrauchs zustimmt, für den Nießbrauchsberechtigten nicht steuerpflichtig.
Hinweis: Die BFH-Urteile betreffen die in der Praxis häufiger vorkommende Übertragung von GmbH-Anteilen eines Elternteils auf das Kind, bei der das Elternteil sich einen Nießbrauch vorbehält. Umfasst dieser Vorbehaltsnießbrauch nicht auch das Stimmrecht und die sonstigen Mitverwaltungsrechte, geht er einkommensteuerlich ins Leere. Die Dividenden muss dann das Kind als Anteilseigner versteuern, und eine vom Kind an das Elternteil gezahlte Abfindung für die Aufhebung des Nießbrauchs ist nicht steuerbar.
2. Kapitaleinkünfte durch Mietminderung einer Genossenschaft
Einkünfte aus Kapitalvermögen kann man auch als Mieter einer Genossenschaft erzielen, wenn man von der Genossenschaft eine Mietminderung dafür erhält, dass man freiwillige Genossenschaftsanteile erworben hat, die weder verzinslich sind noch zu Ausschüttungen berechtigen. Dem BFH zufolge stellt die gewährte Mietminderung einen steuerpflichtigen sonstigen Bezug aus Genossenschaftsanteilen dar, der bei den Kapitaleinkünften zu berücksichtigen ist.
3. Spekulationsgewinne
Nach der Rechtsprechung des BFH kann ein steuerpflichtiger Spekulationsgewinn auch dann entstehen, wenn eine private Immobilie innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist teilweise entgeltlich auf ein Kind im Wege der vorweggenommenen Erbfolge übertragen wird. Die Übertragung ist in ein voll entgeltliches Geschäft und in ein voll unentgeltliches Geschäft nach dem Verhältnis der Gegenleistung zum Verkehrswert des übertragenen Wirtschaftsguts aufzuteilen: Bezüglich des voll entgeltlichen Anteils kommt es innerhalb der Spekulationsfrist zu einem Spekulationsgewinn, wenn der Veräußerungserlös höher ist als die anteiligen Anschaffungskosten; es werden also nicht die gesamten Anschaffungskosten vom Veräußerungserlös abgezogen.
VI. Alle Steuerzahler
1. Erhöhung der Übungsleiterpauschale und Ehrenamtspauschale
Ab 1.1.2026 soll die sog. Übungsleiterpauschale von 3.000 € auf 3.300 € erhöht werden. Die Übungsleiterpauschale ist ein Freibetrag, der insbesondere für nebenberuflich tätige Trainer in Sportvereinen, Ausbilder, Erzieher und Betreuer gilt.
Außerdem soll ab dem 1.1.2026 die sog. Ehrenamtspauschale von 840 € auf 960 € erhöht werden. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Freibetrag, der für nebenberufliche Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich gilt.
Hinweis: Sollte das den geplanten Regelungen zugrunde liegende Gesetz nicht verabschiedet werden oder sollten sich Änderungen ergeben, werden wir Sie hierüber informieren.
2. Verfassungsmäßigkeit der Säumniszuschläge
Der BFH hält die Höhe der Säumniszuschläge von 1 % pro Monat bzw. 12 % pro Jahr aktuell für verfassungsgemäß. Denn seit dem Februar 2022, dem Beginn des Kriegs in der Ukraine, sind die Marktzinsen wieder deutlich und dauerhaft gestiegen, so dass ein etwaiger Zinsanteil, der in den Säumniszuschlägen enthalten sein könnte, nicht überhöht erscheint.
Hinweis: Eine abschließende verbindliche Entscheidung kann allerdings nur das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) treffen, bei dem bislang noch keine Verfahren zur Verfassungsmäßigkeit der Säumniszuschläge anhängig sind.
3. Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags
Der Solidaritätszuschlag ist nicht nur politisch, sondern auch verfassungsrechtlich umstritten, weil es sich nicht um eine Steuer, sondern um eine sog. Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und Körperschaftsteuer handelt. Allerdings haben sowohl der BFH als auch das BVerfG bislang alle Verfahren bzw. Verfassungsbeschwerden gegen den Solidaritätszuschlag zurückgewiesen. Die Finanzverwaltung hat dies nun zum Anlass genommen, alle noch anhängigen Einsprüche gegen die Festsetzung des Solidaritätszuschlags für Veranlagungszeiträume vor 2020 durch eine sog. Allgemeinverfügung zurückzuweisen, soweit es in den Einsprüchen um die Verfassungswidrigkeit des Solidaritätszuschlags ging. Die betroffenen Steuerpflichtigen können hiergegen innerhalb eines Jahres Klage beim Finanzgericht erheben, Fristbeginn war der 30.8.2025.
Hinweis: Die Koalition aus CDU/CSU und SPD hält in ihrem Koalitionsvertrag am Solidaritätszuschlag fest, so dass nach derzeitigem Stand keine Abschaffung des Solidaritätszuschlags zu erwarten ist.
4. Sonderausgaben
Kinderbetreuungskosten können als Sonderausgaben bis zur Höhe von 80 % der Aufwendungen, höchstens mit 4.800 € pro Kind, abgezogen werden. Nicht zu den absetzbaren Kinderbetreuungskosten gehören dem BFH zufolge jedoch Aufwendungen für ein Ferienlager, an dem das Kind in den Ferien teilnimmt. Bei einem Ferienlager steht nämlich nicht die altersbedingt erforderliche Kindesbetreuung, sondern eher die Freizeitgestaltung im Vordergrund.
5. Außergewöhnliche Belastungen
Außergewöhnliche Belastungen sind steuerlich absetzbar, soweit diese die zumutbare Belastung des Steuerpflichtigen übersteigen. Darunter versteht man Aufwendungen, die aufgrund besonderer Umstände zwangsläufig anfallen. Typische Beispiele hierfür sind Krankheitskosten oder Wiederbeschaffungskosten nach dem Untergang des Hausrats durch Feuer oder Hochwasser.
Dem BFH zufolge gehören Aufwendungen für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio nicht zu den außergewöhnlichen Belastungen, selbst wenn die Mitgliedschaft die Teilnahme an einem ärztlich verordneten Funktionstraining im Fitnessstudio ermöglichen soll. Es fehle an der Zwangsläufigkeit der Aufwendungen, weil der Steuerpflichtige nicht gezwungen ist, Mitglied in einem Fitnessstudio zu werden.
Hinweis: Gegen außergewöhnliche Belastungen spricht es im Übrigen, wenn der Steuerpflichtige als Mitglied des Fitnessstudios auch das Schwimmbad und den Saunabereich nutzen kann.
Prozesskosten sind nach dem Gesetz grundsätzlich nicht als außergewöhnliche Belastungen absetzbar. Eine Ausnahme ist vorgesehen, wenn der Steuerpflichtige ohne die Prozessführung Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können. Diese Ausnahme kann nach einem rechtskräftigen Urteil des FG Münster greifen, wenn der Steuerpflichtige seinen geschiedenen Ehegatten auf höheren Unterhalt verklagt und sein Einkommen (einschließlich des bisherigen Unterhalts) ohne den höheren Unterhalt unter dem steuerlichen Existenzminimum liegt.
6. Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen
Der Gesetzgeber gewährt auf Antrag eine Steuerermäßigung für die Durchführung energetischer Maßnahmen im selbstgenutzten Wohngebäude. Im Jahr des Abschlusses der Maßnahme und im Folgejahr können jeweils 7 % der Aufwendungen, maximal 14.000 €, und im übernächsten Jahr 6 % der Aufwendungen, maximal 12.000 €, von der Einkommensteuer abgezogen werden; in dieser Höhe mindert sich also die Einkommensteuer unmittelbar. Voraussetzung ist, dass das begünstigte Objekt älter als zehn Jahre ist und die energetischen Maßnahmen von einem Fachunternehmen durchgeführt werden. Zudem muss der Steuerpflichtige eine Rechnung erhalten haben, die die förderungsfähigen energetischen Maßnahmen, die Arbeitsleistung des Fachunternehmens und die Adresse des begünstigten Objekts ausweist. Auch die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung muss erfolgt sein. Dem BFH zufolge kann die Steuerermäßigung erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die energetische Maßnahme abgeschlossen und vollständig bezahlt worden ist. Demnach wird nicht auf die technische Durchführung abgestellt, sondern auf die vollständige Zahlung der Rechnung.
7. Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen
Sie sollten prüfen, ob im Jahr 2025 Aufwendungen für Handwerker, haushaltsnahe Dienstleistungen oder für Haushaltshilfen angefallen sind. Der Gesetzgeber gewährt hierfür eine Steuermäßigung in Höhe von 20 % der Aufwendungen; die Steuerermäßigung wird ebenso wie die Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen direkt von der Steuer abgezogen. Je nach Art der Dienstleistung gibt es unterschiedliche Höchstbeträge: Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse beträgt der Höchstbetrag 510 €, für haushaltsnahe Dienstleistungen 4.000 € und für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt 1.200 €.
Zu den begünstigten Aufwendungen gehören z. B. die Kosten für den Hausmeister, Gärtner, Winterdienst oder die Hausreinigung. Diese Aufwendungen sind aus der Betriebskosten- oder Wohngeldabrechnung ersichtlich. Für den Abzug der Kosten sind das Vorliegen einer Rechnung sowie die Zahlung auf das Konto des Leistenden erforderlich.
8. Erbschaft- und Schenkungsteuer
Die Gewährung eines unverzinslichen oder zu niedrig verzinsten Darlehens unterliegt im Umfang des Zinsvorteils grundsätzlich der Schenkungsteuer. Dem BFH zufolge bemisst sich dieser Zinsvorteil jedoch nur nach der Differenz zwischen dem vereinbarten (niedrigen) Zinssatz und dem marktüblichen Zinssatz für vergleichbare Darlehen. Es ist also nicht die Differenz zwischen dem vereinbarten Zinssatz und dem gesetzlichen Zinssatz von 5,5 %, der im Bewertungsrecht für Kapitalforderungen gilt, anzusetzen.
Hinweis: Der BFH verlangt nicht, dass der Steuerpflichtige den marktüblichen Zinssatz nachweisen muss. Für die Praxis ist es allerdings ratsam, bereits vor Gewährung des Darlehens den marktüblichen Zins zu ermitteln und diesen zu dokumentieren, um rechtzeitig zu erkennen, ob möglicherweise Schenkungsteuer anfällt, und um im Fall einer Schenkungsteuerfestsetzung durch das Finanzamt Unterlagen über den marktüblichen Zinssatz vorlegen zu können.
Nach dem Gesetz können disquotale Einlagen in eine Kapitalgesellschaft Schenkungsteuer auslösen, wenn es hierdurch zu einer Werterhöhung der Beteiligungen der anderen Gesellschafter kommt. Von einer disquotalen Einlage spricht man, wenn ein Gesellschafter über seine Beteiligungsquote hinaus Einlagen leistet.
Der BFH hält es in einer Entscheidung des vorläufigen Rechtsschutzes für denkbar, dass die Schenkungsteuerpflicht dadurch verhindert werden kann, dass die disquotale Einlage aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses demjenigen Gesellschafter, der sie erbracht hat, personenbezogen zugeordnet wird. Auf diese Weise könnte eine Werterhöhung der Anteile der Gesellschafter, die keine oder eine im Verhältnis zu niedrige Einlage geleistet haben, vermieden werden. Aufgrund dieser Gerichtsentscheidung kann es ratsam sein, eine personelle Zuordnung der Einlagen zum jeweiligen Gesellschafter, der das Geld eingezahlt hat, zu beschließen und in der Buchführung umzusetzen.
Hinweis: Der BFH hat offengelassen, ob eine personenbezogene Zuordnung in der Satzung geregelt werden müsste oder ob eine „gewöhnliche“ schuldrechtliche Vereinbarung genügt. Ferner lässt der BFH offen, ob die Schenkungsteuer auch dadurch vermieden werden kann, dass die Gesellschafter, die eine disquotale Einlage erbringen, nach dem Gesellschaftsvertrag eine höhere Dividende als Ausgleich für ihre disquotalen Einlagen erhalten.
9. Einführung einer sog. Aktiv-Rente
Im Gespräch ist derzeit die Einführung einer sog. Aktiv-Rente. Rentner, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterhin in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis tätig sind, sollen bis zu 2.000 € monatlich steuerfrei hinzuverdienen können; allerdings soll der Hinzuverdienst sozialversicherungspflichtig bleiben. Die Aktiv-Rente soll zum 1.1.2026 in Kraft treten. Ob das Gesetzgebungsvorhaben noch rechtzeitig vor Jahresende abgeschlossen wird, ist unklar, wir halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.
10. Abgabefrist für die Steuererklärung 2024
Steuerpflichtige, die ihre Steuererklärung durch einen Steuerberater oder einen sonstigen Angehörigen der steuerberatenden Berufe erstellen lassen, müssen ihre Steuererklärung für 2024 bis zum 30.4.2026 abgeben. Abweichend hiervon müssen Land- und Forstwirte, die ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben und ihre Steuererklärung durch einen Steuerberater oder einen anderen Angehörigen der steuerberatenden Berufe erstellen lassen, ihre Steuererklärung für 2024 bis zum 30.9.2026 dem Finanzamt übermitteln.
Alle Informationen und Angaben in dieser Mandanten-Information haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.
Rechtsstand ist der 31.10.2025. Über wichtige Änderungen, die bis zum Jahresende umgesetzt werden, informieren wir Sie in einem Update zu dieser Mandanten-Information. Dies gilt ebenfalls in Bezug auf die hier dargestellten geplanten Maßnahmen. Das Update wird voraussichtlich Mitte Januar 2026 veröffentlicht. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!